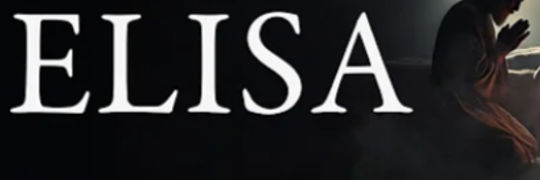
Die Wunder im Leben des Propheten Elisa (2)
Einführung in die Wunder Elisas und ihre Struktur
Mit dem sechsten Wunder auf dem Skript sehen wir die Schwangerschaft der Sunamitin und anschließend die Auferweckung ihres Sohnes. Bevor wir weitermachen, möchte ich einen Hinweis zur Strukturierung dieser sechzehn Wunder geben.
Das erste Wunder, die Teilung des Jordan, war ein Hinweis auf Tod und Auferstehung. Das letzte Wunder, das wir betrachten werden, Nummer 16, handelt ebenfalls von der Totenauferweckung eines Mannes im Grab von Elisa. Somit haben wir am Anfang und am Ende Tod und Auferstehung.
Die weiteren Wunder, eingerahmt von 1 und 16, sind jeweils in Zweiergruppen angeordnet. Zum Beispiel die Heilung des Quellwassers in Jericho, die den Erweis der Gnade Gottes zeigt. Dem gegenüber stehen die zwei Bären, die 42 respektlose Knaben zerreißen – ein Zeichen der Gerechtigkeit Gottes. Gnade und Gerechtigkeit verbinden diese zwei Wunder.
Dann haben wir das Trinkwasserwunder in Edom, das das Thema des Heiligen Geistes behandelt, und die Ölvermehrung im Krug für die verschuldete Frau, die ebenfalls den Heiligen Geist symbolisiert – einmal durch Wasser, einmal durch Öl.
Nun kommen wir zu den Wundern sechs und sieben, die natürlich zusammengehören: die Schwangerschaft der Sunamitin und die Auferweckung ihres Sohnes. Diese bilden wieder eine Zweiergruppe.
So geht es weiter: Die Entgiftung des Eintopfs steht zusammen mit der Vermehrung von Brot und Korn. Danach folgen die Heilung von Naamans Aussatz und der Aussatz, der auf Elisas Knecht Gehasi übergeht.
Wunder zwölf und dreizehn gehören ebenfalls zusammen: das schwimmende Eisen und die geöffneten Augen von Elisas Diener. Im Wunder zwölf geht es um jemanden, der persönlich in große Not und Bedrängnis gerät, während bei Wunder dreizehn ein weltgeschichtliches Ereignis mit vielen Menschen in Not beschrieben wird.
Die Wunder vierzehn und fünfzehn sind eng verbunden: Die syrische Armee wird mit Blindheit geschlagen, und später werden die Augen derselben Armee wieder geöffnet.
Jetzt wenden wir uns der Sunamitin zu und betrachten ihr Wunder etwas genauer. Bei den weiteren Wundern werden wir nicht die Zeit haben, alles im Detail durchzulesen, daher setze ich nur Akzente.
In 2. Könige 4,8 heißt es: „Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Sunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die ihn nötigte, bei ihr zu essen. So oft er vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen.“
Sie sagte zu ihrem Mann: „Sieh doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der ständig bei uns durchzieht. Lass uns ein kleines gemauertes Obergemach machen und ihm Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen. Wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren.“
Sunem ist eine Ortschaft im Norden Israels. Elisa ging dort wiederholt vorbei, und eine Frau erkannte, dass dieser Mann ein treuer Diener Gottes ist. Sie wollte Kontakt zu ihm haben und von ihm profitieren. Deshalb lud sie ihn regelmäßig zum Essen ein, um im Gespräch von ihm zu lernen.
Ihr Mann, den wir noch näher kennenlernen werden, ist ein passiver Mann. Sie dagegen ist aktiv, sucht den Herrn und möchte mit ihm leben und vorankommen. Sie bezieht ihren Mann ein, wo sie kann, und schlägt vor, ein Obergemach einzurichten.
Sehr schön ist, dass sie nicht einfach allein entscheidet, sondern ihren Mann mit einbezieht. In der Bibel gibt es Ehen, in denen ein Miteinander im Dienst sichtbar wird, wie bei Aquila und Priscilla im Neuen Testament. Sie sind ein perfektes Team.
Andere Ehen, wie die von Hiob, sind anders: Hiobs Frau ist kaum präsent und fordert ihn sogar auf, Gott loszulassen. Hiob widerspricht ihr liebevoll, doch sie wird später kaum noch erwähnt. Am Ende bekommt Hiob seine zehn Kinder zurück, aber die Gemeinschaft zwischen ihm und seiner Frau bleibt nicht so ausgeprägt wie bei Aquila und Priscilla.
Auch die Sunamitin lebt ihre Ehe und investiert darin, doch es ist kein vollständiges Zusammengehen. Sie hat die Ideen und erkennt geistliche Dinge. So sagt sie: „Wir könnten dieses Obergemach machen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinsetzen.“ Das ist das absolute Minimum an Ausstattung.
Obwohl sie wohlhabend war, gab sie Elisa keinen Luxus, sondern nur das, was er wirklich braucht. Nicht, dass der Prophet sagt: „Ich liebe es, nach Sunem zu gehen, dort kann ich im Luxus schwelgen.“ Ein Bett steht für Ruhe, ein Tisch für Gemeinschaft, ein Stuhl für das Studium und ein Leuchter für Licht in der Dunkelheit. Diese vier Dinge braucht man für den Dienst: Ruhe im Herrn, Gemeinschaft mit Geschwistern, Studium des Wortes und Licht in der Dunkelheit.
In Vers 11 heißt es: „Und es geschah eines Tages, da kam er dahin, kehrte ins Obergemach ein und schlief dort. Er sprach zu Gehasi, seinem Knaben: ‚Rufe die Sunamitin!‘“
Gehasi rief sie, und sie trat vor ihn. Elisa fragte: „Was kann ich für dich tun? Soll ich mit dem König oder dem Heerobersten sprechen?“ Elisa wollte sich bedanken und bot ihr Unterstützung an, da er Beziehungen bis in die höchsten Ränge Israels hatte.
Sie antwortete: „Ich wohne inmitten meines Volkes. Ich brauche keine Beziehungen nach oben.“ Sie war zufrieden in der Gemeinschaft ihres Volkes, dem Volk Gottes. Das ist bemerkenswert. Es gibt Geschwister, die am Rand der Gemeinde stehen, doch sie war fest verankert und zufrieden.
Gehasi bemerkte jedoch, dass sie keinen Sohn hatte und ihr Mann alt war. Obwohl er nicht geistlich war und später als geldgierig erscheint, erkannte er dennoch, was ihr fehlte.
Sie war verheiratet, doch hatte keinen Nachwuchs – ein oft verborgenes Leid. Manche sind unverheiratet und wünschen sich eine Ehe, andere sind verheiratet, aber haben keinen Kindersegen. Die Sunamitin sagte, sie sei zufrieden, doch der Wunsch nach einem Kind war da.
Elisa rief sie und prophezeite: „Zu dieser bestimmten Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen.“ Das erinnert an Gottes Zusage an Abraham und Sarah in 1. Mose 18,14.
Sie konnte es kaum glauben und sagte: „Mein Herr, du Mann Gottes, belüge deinen Knecht nicht.“ Doch die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zur bestimmten Zeit, wie Elisa gesagt hatte. Das ist das sechste Wunder Elisas und steht wieder im Zusammenhang mit Leben.
Oft begegnet in diesen Wundern das Thema Tod und Leben. Das muss man vor dem Hintergrund der Religion der Kanaaniter sehen, wie auf der zweiten Seite des Skripts beschrieben. Der Hauptgott der Kanaaniter war El, was „der Starke“ bedeutet und mit „Gott“ übersetzt wird. Es gibt auch Eloah und Elohim, die in der Bibel für Gott stehen, aber El bezeichnet speziell den starken Gott.
Die Kanaaniter hatten ihren höchsten Gott El, doch Baal, sein angeblicher Sohn, wurde am meisten verehrt. Elisa, hebräisch Elisha, bedeutet „Mein El ist Rettung“. Sein Name enthält „El“, aber nicht den Götzen El der Kanaaniter, sondern den wahren Gott der Bibel, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Elija, sein Vorgänger, heißt „Mein El ist Jah“ – eine Kurzform von Jahwe, dem biblischen Eigennamen Gottes, der fast 7000-mal vorkommt und „der Ewige“ bedeutet.
Baal wurde als Sohn von El verehrt, als Blitz-, Regen- und Gewittergott, zuständig für Fruchtbarkeit und Nahrung. Er wurde als Kriegsgott dargestellt und als Bezwinger von Meeres- und Totengöttern verehrt.
Diese Religion ist eine dämonische Imitation von Gott Vater und Sohn. Baal wurde auch mit Unzucht als Verehrungsform verbunden – etwas sehr Abscheuliches.
Asherah wurde als Schöpfergöttin, Gebärerin der Götter und Schutzpatronin der Mutterschaft verehrt.
Alle Wunder bei Elija und Elisa zeigen, dass nicht El, Baal oder Asherah wirken, sondern Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Baal wurde als Gott dargestellt, der starb, wenn die Sommerhitze kam und alles verdorrte. Nach der Regenzeit sagten die Kanaaniter, Baal sei auferstanden. So wurde er als Sohn Gottes verehrt, der starb und wieder auferstand.
Satan hat diese Religion bewusst so gestaltet, um die Wahrheit zu verdrehen und zu lästern. Darum ist El, Baal und Asherah eine teuflische Imitation der Dreieinigkeit Gottes.
Diese Wunder zeigen, dass Gott Israels herrscht: Die Heilung des Quellwassers in Jericho, das Trinkwasserwunder in Edom, die Ölvermehrung, die Schwangerschaft der Sunamitin und die Auferweckung ihres Sohnes – alles wirkt der Götzenverehrung entgegen.
Gott hat diese Zeichen bewusst gewählt, um Israel klarzumachen, dass ihr Götzendienst ein Irrweg ist.
So versteht man auch den Gottesbeweis auf dem Berg Karmel bei Elija (1. Könige 17). Baal, als Berggott, sollte Feuer vom Himmel senden, doch das konnte er nicht. Elia betete, und Feuer kam vom Himmel. Danach kam der Regen und beendete die Dürre. Nicht Baal, sondern der Herr hat gehandelt.
Die Frau wurde schwanger, gebar einen Sohn zur bestimmten Zeit, wie Elisa prophezeit hatte. Das Kind wuchs heran, doch eines Tages klagte es: „Mein Kopf, mein Kopf!“ Sein Vater sagte zum Diener: „Trag ihn zu seiner Mutter!“ Der Junge setzte sich auf ihre Knie und starb.
Der Vater zeigt keine Nähe zum Kind. War es für ihn keine große Freude, dass seine Frau ein Kind bekam? Er schickt den Jungen zur Mutter. Bei ihr ist es anders: Das Kind sitzt auf ihren Knien, ein wichtiger Platz für kleine Kinder, wo sie Beziehung und Einfühlung spüren. Sie hält ihn, und er stirbt in ihren Armen – ein großer Schmerz, den sie nicht mit ihrem Mann teilen kann.
Sie legt den Jungen auf das Bett des Mannes Gottes, schließt die Tür zu und geht hinaus. Dann ruft sie ihren Mann und bittet um einen der Diener und eine Eselin, um zum Mann Gottes zu laufen.
Ihr Mann versteht nicht, warum sie geht. Er denkt an Rituale wie Neumond und Sabbat, nicht an das Herzproblem seiner Frau. Sie antwortet: „Es ist gut“ – das hebräische Wort „Shalom“ bedeutet Friede. Sie sucht Frieden, sattelt die Eselin und sagt ihrem Diener, er solle sie unaufhaltsam führen.
Sie reitet zum Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Als Elisa sie aus der Ferne sieht, schickt er Gehasi, seinen Diener, ihr entgegen, um zu fragen, ob es ihr gut geht. Sie antwortet „Shalom“, obwohl ihr Kind tot ist. Sie hat Frieden mit Gott.
Sie umarmt Elisas Füße in der Hoffnung, dass er ihr helfen kann. Gehasi will sie wegstoßen, doch Elisa hält ihn zurück und sagt, ihre Seele sei betrübt. Der Herr hat ihm das Problem nicht offenbart.
Sie sagt: „Habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Täusche mich nicht!“ Elisa gibt Gehasi den Auftrag, seine Lenden zu gürten, den Stab zu nehmen, niemanden zu grüßen und den Stab auf das Gesicht des Knaben zu legen.
Die Frau hält fest an Elisa, der einzige, der ihr helfen kann. Elisa macht sich auf den Weg, Gehasi geht voraus und legt den Stab auf das Kind, doch es regt sich nichts.
Das erinnert an Markus 9,18, wo die Jünger einen Besessenen nicht heilen konnten wegen ihres Unglaubens. Gehasi kehrt zurück und berichtet, dass der Knabe nicht erwacht ist.
Als Elisa ins Haus kommt, sieht er den toten Jungen auf seinem Bett. Er schließt die Tür hinter sich und betet zum Herrn, wie in Matthäus 6,6 beschrieben.
Er steigt auf das Bett, legt seinen Mund auf den Mund des Kindes, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Er identifiziert sich mit dem Jungen in seinem Reden, Sehen und Tun.
Das Fleisch des Kindes wird warm. Elisa weist auf den Herrn Jesus hin, der sich am Kreuz mit uns identifizierte, starb und auferstand, sodass wir sagen können: Sein Tod ist mein Tod, seine Auferstehung meine Auferstehung.
Elisa beugt sich über das Kind, das Fleisch wird warm. Er geht einmal hin und her, beugt sich erneut über ihn, der Junge niest siebenmal und öffnet die Augen.
Elisa ruft die Sunamitin und sagt ihr, sie solle ihren Sohn nehmen. Sie fällt ihm zu Füßen, beugt sich nieder und nimmt ihren Sohn mit hinaus.
Diese Auferstehung geschieht in einer Zeit, in der der Baalskult unter Ahab, Ahasja und Joram seinen Höhepunkt erreicht hatte – im Abfall Israels.
Alle drei Auferstehungsgeschichten im Alten Testament finden in dieser Zeit statt: Elija hat einen Jungen auferweckt, Elisa ebenso, und später wird ein Toter durch Berührung von Elisas Gebeinen auferweckt.
Elisa ist ein Bild auf den Herrn Jesus, durch dessen Tod es Leben für uns gibt. Das ist das sechzehnte Wunder.
Wir gehen weiter zu Vers 38: Elisa kehrte nach Gilgal zurück. Es war Hungersnot im Land, und die Söhne der Propheten saßen vor ihm. Er befahl seinen Knaben, einen großen Topf aufzustellen und ein Gericht für die Söhne der Propheten zu kochen.
Diese Söhne der Propheten wurden von Elisa geschult und spielten eine wichtige Rolle in der Geschichte Israels, auch bei der Überlieferung der Bibelrollen.
Man kann diese Versammlung mit der Gemeinde vergleichen, und Elisa ist ein Bild auf den Herrn Jesus, der in Matthäus 18,20 sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Es war Hungersnot, und manchmal fühlt man in der Gemeinde, dass man keine geistliche Nahrung mehr bekommt, dass die Verkündigung oberflächlich ist – das ist gefährlich.
Vers 39: Einer ging aufs Feld, um Kräuter zu sammeln, fand eine wilde Ranke mit giftigen Kolloquinten, die abführend und tödlich sein können.
Er schnitt die Pflanze und gab sie in den Kochtopf, weil sie die Pflanze nicht kannten.
Vers 40: Als die Männer von dem Gericht aßen, schrien sie: „Der Tod ist im Topf, Mann Gottes!“ Sie konnten es nicht essen.
Elisa sagte: „Hol Mehl her!“ Er warf es in den Topf und sagte, sie sollten es ausschütten, damit sie essen könnten. Danach war nichts Schlimmes mehr im Topf.
Das Mehl wird hier zum übernatürlichen Hilfsmittel, das alles neutralisiert. Es erinnert an das Speisopfer, das auf das vollkommene Leben Jesu hinweist.
Wenn giftige Dinge in die Gemeinde kommen, ist gesunde Lehre, die den Herrn Jesus in den Mittelpunkt stellt, das Gegenmittel.
Nun zum neunten Wunder, Vers 42: Ein Mann kam von Baal-Schalisha und brachte dem Mann Gottes zwanzig Gerstenbrote und Jungkorn in einem Sack.
Elisa sagte: „Gib es den Leuten, damit sie essen!“ Sein Diener fragte, wie er hundert Männern so wenig Brot vorsetzen solle.
Elisa antwortete: „Gib es den Leuten, damit sie essen, denn so spricht der Herr: Man wird essen und übrig lassen.“
Sie aßen und hatten genug, wie der Herr es gesagt hatte.
Diese Brote waren eigentlich für den Tempel bestimmt, doch die zehn Stämme im Nordreich waren vom Tempel abgeschnitten.
Der Mann von Baal-Schalisha gehörte offensichtlich zum Überrest, wie bei Elia, der 7000 übrig gelassen hatte, die Baal nicht anbeteten.
Diese Brote symbolisieren das gesunde Wort Gottes, besonders die Gerstenbrote erinnern an Johannes 6,9, wo ein kleiner Junge fünf Gerstenbrote und Fische gab, die Jesus vermehrte.
Jesus sagt in Johannes 6,51: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben.“ Das zeigt, dass die einmalige Bekehrung ewiges Leben schenkt.
Weiter zum zehnten Wunder, Kapitel 5: Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann und Kriegsheld, doch er war aussätzig.
Aussatz ist eine schreckliche Krankheit, die von innen kommt, ein Bild für die Sünde, die wir von Adam geerbt haben.
Naaman hatte große Karriere gemacht, war aber krank.
Ein kleines Mädchen, als Kriegsgefangene nach Syrien gebracht, wurde Hausmädchen der Frau Naamans. Sie sagte, Naaman solle zu Elisa gehen, der könne ihn heilen.
Naaman ging nach Israel, suchte Elisa auf, doch Elisa kam ihm nicht entgegen.
Nach 3. Mose 13,14 mussten Aussätzige soziale Distanz halten, außerhalb der Städte leben und Mundschutz tragen.
Elisa sagte zu Naaman, er solle sich siebenmal im Jordan baden.
Naaman wurde wütend, weil er eine große Show erwartete, doch Elisa forderte nur das einfache Untertauchen.
Er dachte, die Flüsse Abana und Pharpar bei Damaskus seien besser als der Jordan.
Er wandte sich zornig ab.
Manche verpassen die Rettung, weil sie das Evangelium zu einfach finden.
Naaman wurde von seinen Knechten ermutigt, und schließlich tauchte er siebenmal im Jordan unter.
Sein Fleisch wurde wie das eines jungen Knaben, und er war rein.
Er erkannte, dass der Gott Israels der wahre Gott ist.
Naaman wollte viel Reichtum als Dank geben, doch Elisa nahm nichts an, weil Rettung nicht gekauft werden kann.
Als Naaman zurückkehrte, schlich sich Gehasi, Elisas Knecht, hinterher und forderte Geld.
Naaman gab ihm zwei Talente Silber und teure Kleider.
Gehasi nahm das Geld, doch Elisa deckte sein Tun auf und sagte, dass der Aussatz auf Gehasi und seinen Nachkommen haften werde.
Das elfte Wunder zeigt, wie der Aussatz auf Gehasi kam, der die Rettung für Geld verkaufen wollte.
In der Kirchengeschichte gab es ähnliche Skandale mit dem Verkauf von Ablässen.
Nun, in Kapitel 6, baten die Söhne der Propheten Elisa, einen größeren Wohnort zu schaffen, da es ihnen zu eng wurde.
Sie wollten an den Jordan gehen und dort einen Ort herrichten.
Elisa ging mit ihnen, ein Bild auf Jesus, der mit seiner Gemeinde geht.
Am Jordan fällte einer einen Baum, doch die Axt fiel ins Wasser.
Der Mann schrie: „Ach, mein Herr! Die Axt war geliehen!“
Elisa schnitt ein Holz ab, warf es ins Wasser, und die Axt schwamm.
Das erinnert an 2. Mose 15,25, wo Mose ein Holz ins bittere Wasser warf, das dadurch süß wurde.
Das Holz ist ein Bild für das Kreuz Jesu, durch das das Bittere im Leben süß wird.
Durch das Kreuz wird uns das Leben geschenkt, um Gott zu dienen.
Dann wollte der König von Syrien gegen Israel Krieg führen und hatte es auf den König abgesehen.
Elisa warnte den König immer wieder, sodass die Syrer überrascht wurden.
Der König von Syrien fragte, ob jemand aus seiner Armee alles verrate.
Ein Soldat sagte, Elisa sei schuld, weil er durch den wahren Gott alles weiß.
Die Syrer marschierten nach Dothan, der Ort, den wir aus der Josefsgeschichte kennen.
Dort betete Elisa, dass der Herr die Augen seines Dieners öffne.
Der Diener sah den Berg voller feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa – Engel, die sie beschützen.
Das erinnert an Matthäus 26, wo Jesus sagte, er könne zwölf Legionen Engel rufen.
Auch in 1. Mose 32 und Psalm 34,8 wird von Engeln gesprochen, die Gläubige schützen.
Elisa bat, dass dem Diener die Augen geöffnet werden, und er sah die Engel.
Das ist das dreizehnte Wunder.
Das vierzehnte Wunder: Elisa betete, dass das Volk der Syrer blind werde, und sie wurden blind.
Elisa führte sie nach Samaria, sagte ihnen, dass dies nicht der richtige Weg sei, und brachte sie zum König.
Dort sagte der König zu Elisa, ob er sie schlagen solle.
Elisa antwortete, dass sie nicht geschlagen werden sollten, sondern Brot und Wasser bekommen sollten.
Sie aßen, tranken und zogen zu ihrem Herrn zurück.
Seitdem kamen die Syrer nicht mehr in das Land Israel.
Das ist ein Beispiel für Liebe zu Feinden, wie in Sprüche 25,21-22 und Römer 12 beschrieben.
Das ist fantastisch: Die Feinde bekamen ein Mahl und gingen in Frieden.
Ich habe in Samaria auch einmal ein solches Essen erlebt, das sehr edel war.
Das war Frieden für eine Zeit.
Das letzte Zeichen haben wir schon besprochen.
In Kapitel 13,20: Elisa starb und wurde begraben.
Als Streifscharen der Moabiter ins Land kamen, warfen sie einen Mann in Elisas Grab.
Als der Mann die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stand auf.
Das sechzehnte Wunder zeigt, dass Elisas Tod noch zum Segen wirkt.
Wie es in Sprüche heißt: „Das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen.“
In Hebräer 13 wird aufgerufen, den Glauben der Führer nachzuahmen.
So wirkt jemand, der Gott gedient hat, über den Tod hinaus zum Segen.
Das ist ein Hinweis auf Tod und Auferstehung, die nur der wahre Gott bewirken kann.
Vielen Dank für die Geduld trotz der Überzeit.
Die theologische Bedeutung der Wunder im Kontext der kanaanitischen Religion
Und das muss man vor folgendem Hintergrund sehen: Auf der zweiten Seite hier im Skript habe ich überschrieben zur Bedeutung von El, Baal und Asherah in der Religion der Kanaaniter.
Der Hauptgott der Kanaaniter war El. El heißt „der Starke“ und wird korrekt mit „Gott“ übersetzt, aber eben im Sinn von „Gott, der Starke“. Es gibt auch das Wort Eloah, und die Mehrzahl Elohim wird im Deutschen ebenfalls mit „Gott“ übersetzt. Die Elbefelder geben Hinweise, wenn El im Text steht. Meistens steht Elohim, und dann gibt es eine Reihe von Stellen mit Eloah und eben auch mit El. Eloi, Elohim bezeichnet Gott als den Verehrungswürdigen, den Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Aber El ist speziell der starke Gott.
Nun ist es so, dass die Kanaaniter ihren höchsten Gott – man muss sagen ihren höchsten Götzen – ebenfalls El nannten, also den gleichen Namen verwendeten. Genau darin liegt das Problem im arabischen Kulturkreis, wenn man mit den Leuten spricht. Fragt man: „Wie geht es dir?“, dann kommt die Antwort: „Hamdulahi, Allah sei Dank.“ Das sagen sowohl Muslime als auch Christen, weil in der arabischen Bibel für Gott auch das Wort Allah steht.
Al-Ila, Ila ist einfach das normale Wort für Gott in den semitischen Sprachen. Al ist der Artikel, also „der Gott“. Im Islam ist das die Bezeichnung für den Gott des Korans, der eben nicht der Gott der Bibel ist – ganz klar nicht. Aber im Alltag sagt ein Christ auf die Frage „Wie geht es dir?“ ebenfalls „Hamdulahi“.
Ich habe das immer wieder gedacht, wenn ich Sie so begrüßt habe: Wenn derjenige wüsste, dass ich einen anderen Gott meine. Aber gut, er muss es ja wissen, ich bin kein Muslim und glaube nicht an seinen Gott, sondern an den Gott der Bibel. Das ist eigentlich hilfreich, sonst gäbe es im Alltag ständig Konflikte im Umgang mit Muslimen. Nachher im Gespräch wird dann klar, dass man einen anderen Gott meint.
So war es auch damals: Die Israeliten sprachen über El, und die Bibel benutzt El, aber die Kanaaniter sprachen auch über El. Es ist so, dass El zwar theoretisch der höchste Gott ist, aber Baal, sein angeblicher Sohn, wurde eigentlich am meisten von den Kanaanitern verehrt.
Übrigens heißt Elisa auf Hebräisch Elisha „Mein El ist Rettung“. Also trägt Elisa diesen Namen mit El in sich. Aber natürlich ist damit nicht der Hauptgott der Kanaaniter gemeint, sondern der wahre Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Elija, sein Vorgänger, der ihn in den Dienst eingeführt hat, heißt „Mein El ist Jah“. Jah ist die Kurzform von Yahweh, und das ist eindeutig. Yahweh ist in der Bibel der Eigenname des wahren Gottes, kommt fast siebentausendmal vor und bedeutet „der Ewige, der Unwandelbare“. Im Deutschen wird es meist mit „Herr“ mit Großbuchstaben übersetzt.
Elija sagt also: „Mein El ist Yahweh“, damit wird klargemacht, dass nicht der Gott der Kanaaniter gemeint ist. Die Kanaaniter sprachen nicht von Yahweh, und damit war schon eine Klärung gegeben – durch Elija, aber auch durch Elisha mit „Mein El ist Rettung“.
Baal, wie man auf dem Skript sieht, wurde als Sohn von El, also als Sohn Gottes, verehrt. Er war bei den Kanaaniten der Blitz-, Regen- und Gewittergott. Er galt als Berggott, die Aramäer nannten ihn Hadad. Er war verantwortlich für Regen und Fruchtbarkeit, für Nahrung auf dem Feld, zuständig für Wasser, Brot, Öl, Wein, Gras und Kraut als Nahrung für das Vieh.
Baal wurde verehrt als der Beender von Dürreperioden. Er wurde dargestellt als Mann mit Donnerkeule in der rechten und Blitzspeer in der linken Hand, zum Teil auch als Stier. Außerdem war er ein typischer Kriegsgott, der in ihrer Mythologie die Götter wie Yam, den Meergott, und Mott, den Todesgott, besiegte.
Man sieht hier also eine dämonische, satanische Imitation von Gottvater und Gottsohn mit El und Baal. Baal wurde auch im Zusammenhang mit Unzucht verehrt, die als Verehrungsform für Baal praktiziert wurde – wirklich etwas sehr Perverses! Es fällt schwer, darüber zu sprechen, aber es ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, was mit dieser Verehrung von Baal verbunden war.
Asherah wurde als Schöpfergöttin, Gebärerin der Götter und auch als Schutzpatronin in Bezug auf Mutterschaft verehrt.
Jetzt sieht man all diese Wunder bei Elija und dann bei Elisa. Das sind immer Wunder, die gerade zeigen sollen, dass nicht El, nicht Baal, nicht Asherah, sondern Yahweh, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wirkt.
Baal wurde auch verehrt als Gott, der starb, wenn die Sommerhitze kam und alles im Land Kanaan, im Land Israel, verdorrte. Dann sagten die Kanaaniter: „Jetzt ist Baal gestorben.“ Nach der Regenzeit im Frühjahr, wenn alles wieder auflebt und die Fruchtbarkeit des Erdbodens sichtbar wird, sagten sie: „Baal ist auferstanden.“
Er wurde also als Sohn Gottes verehrt, der starb und wieder auferstand. Man sieht, Satan hat das bewusst so in dieser Religion aufgebaut. Das findet man auch in anderen Religionen, um die Wahrheit zu verdrehen und zu lästern.
Darum habe ich auf dem Blatt El, Baal, Asherah geschrieben: Das ist eine teuflische Imitation der Dreieinheit Gottes.
Jetzt wird gerade klar: Bei all diesen Wundern, wie der Heilung des Quellwassers in Jericho, hat nicht Baal gewirkt, sondern Gott Israels. Das Trinkwasserwunder in Edom hat nicht Baal bewirkt, sondern der Herr. Die Ölvermehrung nicht Baal. Die Schwangerschaft der Sulamitin hat nicht Asherah bewirkt, sondern der wahre Gott.
Und jetzt geht es um die Auferweckung des Sohnes der Sonamitin. Das hat nicht Baal gemacht, der Gott des Todes und der Auferstehung, sondern der wahre Gott.
So könnte man weiterfahren. Gott hat ganz bewusst diese Zeichen und Wunder gewählt, um zu Israel damals zu sprechen und ihnen klarzumachen, dass ihr Götzendienst ein totaler Irrweg war.
Man versteht zum Beispiel auch, warum der Gottesbeweis auf dem Karmel bei Elija stattfand (1. Könige 17). Warum war das auf einem Berg? Weil Baal als Berggott verehrt wurde.
Warum sollten die Baalspriester Feuer vom Himmel herabkommen lassen? Weil Baal der Blitzgott ist und einen Blitz senden sollte, um das Opfer zu verzehren. Er konnte es aber nicht.
Das schlichte Gebet von Elija führte dazu, dass das Feuer vom Himmel kam. Danach kam der Regen nach der Dürreperiode. Nicht Baal hat das beendet, sondern der Herr.
Ganz bewusst war das so gewählt. Darum auch dieses Wunder, und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu dieser bestimmten Zeit im Jahresverlauf, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Nicht die Baalspropheten hatten das gesagt, sondern Elisa.
Der Tod des Sohnes und die Reaktion der Eltern
Und das Kind wuchs heran, und es geschah eines Tages, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging. Es sprach zu seinem Vater: „Mein Kopf, mein Kopf!“
Der Vater sagte zu dem Diener: „Trag ihn zu seiner Mutter!“ Der Diener nahm das Kind auf und brachte es zu seiner Mutter. Dort saß es auf ihren Knien bis zum Mittag – und dann starb es.
Was für ein Vater ist das! Der kleine Junge kommt zu ihm und sagt: „Ich habe solche Kopfschmerzen!“ Doch das waren keine normalen Kopfschmerzen, sondern ein furchtbarer Schmerz. Der Vater reagiert kühl und sagt: „Bring ihn zu seiner Mutter.“ Es gibt keine Beziehung zum Kind. War es für ihn nicht eine große Freude, dass seine Frau dieses Kind bekam? Doch er schickt das Kind einfach zur Mutter.
Bei der Mutter ist es ganz anders. Der Sohn darf auf ihren Knien sitzen. Das ist ein ganz wichtiger Platz für kleine Kinder, an dem sie Beziehung und Einfühlungsvermögen spüren. Die Mutter hat ihn auf den Knien, und dann stirbt er in ihren Armen. Was für ein Schmerz das gewesen sein muss! Aber sie kann diesen Schmerz nicht mit ihrem Mann teilen.
Sie ging hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss die Tür hinter sich und ging hinaus. Dann rief sie ihren Mann. Sie bezieht ihn ein, wo sie nur kann. Sie investiert weiter in die Ehe, auch wenn sie schwierig war.
Sie sagt: „Sende mir doch einen von den Dienern und eine von den Eselinnen, und ich will zu dem Mann Gottes laufen und wiederkommen.“ Doch ihr Mann fragt: „Warum willst du heute zu ihm gehen?“ Er denkt nicht daran, dass der Mann Gottes die Ursache war, dass sie überhaupt schwanger werden durfte. Und jetzt, wo sie das Kind verliert, will sie zum Mann Gottes. Doch er denkt nur an Rituale. Es ist weder Neumond noch Sabbat, und er versteht nicht, was in seiner Frau vorgeht.
Sie antwortet: „Es ist gut.“ Das hebräische Wort hier ist „Shalom“, was Frieden bedeutet. Sie merkt, dass sie mit ihm das nicht teilen kann, aber sie sucht den Frieden. Sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener: „Treibe immer fort, halte mich nicht auf, es sei denn, ich sage es dir.“ Ihr Eifer ist jetzt sehr groß.
So zog sie hin und kam zum Mann Gottes auf den Berg Karmel. Der Mann ist nicht mitgegangen, obwohl sie zusammen hätten reiten können. Sie hatten nicht nur einen Esel, sie waren wohlhabend.
Als der Mann Gottes sie von fern sah, sprach er zu Gehasi, seinem Diener: „Sieh dort die Sonamitin, lauf ihr entgegen und sprich zu ihr: Geht es dir gut?“ Wörtlich heißt es auf Hebräisch: „Hast du Frieden?“ – Shalom. „Geht es deinem Mann gut? Hat dein Mann Frieden? Geht es dem Kind gut? Hat dein Kind Frieden?“
Sie antwortete: „Shalom.“ Sie wusste, dass das Kind beim Herrn war und Frieden hatte. Sie selbst hatte schon Frieden mit Gott, und ihr Mann hatte seinen Frieden. Doch sie ging gar nicht auf Gehasi ein, weil sie wusste, dass auch er sie nicht versteht.
Sie kam zum Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Sie hatte nur eine Hoffnung: Dass dieser Mann Gottes, der in enger Beziehung zum wahren Gott stand, ihr helfen kann. Niemand sonst konnte helfen – nur Elisa.
Da trat Gehasi zu ihr, um sie wegzustoßen. Er verstand nicht, worum es ging, und wollte sie hindern. Doch der Mann Gottes sagte: „Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt.“ Er erkannte, dass die Frau ein großes inneres Problem hatte. Der Herr hatte es ihm verborgen und nicht offenbart. Er hatte keine Vision im Voraus erhalten.
Die Frau sprach: „Habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt: Täusche mich nicht?“ Da sprach Gehasi: „Gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in die Hand und geh hin. Wenn du jemanden triffst, grüße ihn nicht, und wenn dich jemand grüßt, antworte nicht.“
Das war ihm klar: Jetzt muss es eilig gehen. Im Orient bedeutet Grüßen oft, noch etwas zusammen zu trinken – das wäre Zeitverlust. Einfach an den Leuten vorbeigehen, denn jetzt geht es nur um das Problem dieser Frau. „Antworte nicht!“
„Lege meinen Stab auf das Gesicht des Knaben!“ Die Mutter des Knaben sprach: „So wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse!“ Diese Frau war so mit Elisa verbunden, dass sie nicht von ihm ließ. Nur er konnte ihr helfen.
Jetzt musste Elisa mitgehen. Er machte sich auf und ging ihr nach. Gehasi war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Knaben gelegt. Doch es gab keine Stimme und kein Aufmerken.
Das erinnert an die Jünger in Markus 9,18, die einen Besessenen nicht heilen konnten wegen ihres Unglaubens. Es ging nicht, und auch der Stab von Elisa half nicht. Gehasi kehrte zurück und berichtete: „Der Knabe ist nicht erwacht.“
Die Auferweckung des Sohnes durch Elisa
Als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Knabe tot, hingelegt auf seinem Bett. Er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu – wieder eine verschlossene Tür, wie beim Beten. So wie in Matthäus 6,6 betete er zu dem Herrn.
Er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind. Dabei legte er seinen Mund auf dessen Mund, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände. Er identifizierte sich mit diesem Jungen: im Reden durch den Mund, in der Erkenntnis durch die Augen und im Tun durch die Hände. Er beugte sich über ihn, und das Fleisch des Kindes wurde warm.
Elisa ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, den großen Propheten, der einmal kommen sollte. Jesus hat sich am Kreuz mit uns identifiziert. An unserer Stelle ist er gestorben und wieder auferstanden, sodass wir sagen können: Sein Tod ist mein Tod und seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Wir haben es gelesen: Das Fleisch des Kindes wurde warm.
Elisa kam zurück und ging ins Haus, einmal hierhin und einmal dorthin. Dann stieg er wieder hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Knabe siebenmal, und der Knabe schlug seine Augen auf.
Er rief Gehasi und sprach: „Rufe diese Sunamitin!“ Er rief sie, und sie kam zu ihm herein. Er sprach: „Nimm deinen Sohn.“ Da kam sie, fiel ihm zu Füßen und beugte sich zur Erde nieder. Sie nahm ihren Sohn und ging hinaus.
Wieder eine Auferstehung – und das ausgerechnet in dieser Zeit, in der der Baalskult unter Ahab, Ahasja und Joram seinen Höhepunkt erreicht hatte, im Abfall Israels. Alle drei Auferstehungsgeschichten im Alten Testament finden in dieser Zeit statt. Elija hat auch einen Jungen auferweckt, nicht wahr? Und Elisa ebenso, wie wir noch sehen werden.
Als Elisa starb und ein Toter in sein Grab geworfen wurde, kam dieser Tote in Kontakt mit Elisa. Auch hier, durch den Tod von Elisa, kam es zur Auferstehung.
Elisa ist ein Bild auf den Herrn Jesus: Durch seinen Tod gibt es Leben für uns. Das ist dann das Wunder Nummer sechzehn.
Die Hungersnot und das Entgiften des Eintopfs
Gehen wir weiter. Vers 38: Elisa kehrte nach Gilgal zurück, und im Land herrschte Hungersnot. Die Söhne der Propheten saßen vor ihm. Er sprach zu seinen Knaben: „Setzt den großen Topf auf und kocht ein Gericht für die Söhne der Propheten.“
Diese Söhne der Propheten wurden von Elisa unterrichtet. Es lohnt sich, diesem Thema in der Bibel weiter nachzugehen, denn diese Söhne der Propheten spielten in der Geschichte Israels eine wichtige Rolle. Auch sind sie mit der Überlieferung der Bibelrollen verbunden. Die biblischen Bücher und ihre Überlieferung stehen in Zusammenhang mit diesen Söhnen der Propheten.
Elisa war gewissermaßen ihr Mentor. Man kann also sagen, dass die Versammlung der Söhne der Propheten zusammen mit Elisa ein schönes Bild für die Gemeinde ist. Elisa ist ein Bild für den Herrn Jesus, der in Matthäus 18,20 sagt: „Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Doch es herrschte Hungersnot. Es gibt Momente, in denen man in der Gemeinde das Gefühl hat, keine geistliche Nahrung mehr zu erhalten. Die Verkündigung wirkt oberflächlich und leer, und das ist gefährlich.
Vers 39: Da ging einer hinaus aufs Feld, um Kräuter zu sammeln. Er fand eine wilde Ranke und pflückte davon wilde Kolloquinten. Diese sind wirklich gefährlich. Sie wirken abführend und können sogar tödlich sein.
Sein Gewand war voll, und er kam zurück und schnitt die Kräuter in den Kochtopf, denn sie kannten sie nicht. Er holte also etwas, um die Hungersnot der Gemeinde zu stillen. Manche machen das ähnlich: Sie gehen zwar nicht aufs Feld, aber sie suchen im Internet nach „geistlicher Nahrung“. So kommt dann etwas ganz anderes in die Gemeinde hinein.
Vers 40: Sie schütteten das Gericht zum Essen für die Männer aus. Doch als sie davon aßen, schrien sie und sagten: „Der Tod ist im Topf, Mann Gottes! Das ist giftig, was wir da zu essen bekommen!“ Sie konnten es nicht essen.
Da sprach Elisa: „Holt Mehl her!“ Er warf es in den Topf und sagte: „Schüttet es aus für die Leute, damit sie essen!“ Und es war nichts Schlimmes mehr im Topf.
Das Mehl wird hier zum übernatürlichen Hilfsmittel, das alles neutralisiert. Ich habe bereits im Zusammenhang mit dem Speisopfer erklärt, dass es für das vollkommene Leben des Herrn Jesus steht, das in Verbindung mit den blutigen Opfern Gott dargebracht wurde.
Auch hier ist das Mehl ein Bild für den Herrn Jesus und sein Leben. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir nicht einfach Körner, sondern ein Leben, das dargestellt wird. Wie er gesprochen und gehandelt hat, alles ist klar und vollkommen an ihm.
Wenn also giftige Dinge in die Gemeinde kommen, ist es wichtig, die gesunde Lehre zu bewahren. Gerade die Vollkommenheit, die den Herrn Jesus ins Zentrum stellt, wirkt neutralisierend auf das Gift.
Die Brotvermehrung und das Zeichen des lebendigen Brotes
Wir kommen zu Wunder neun, Vers 42:
Ein Mann kam von Ba'al Schalisha und brachte dem Mann Gottes Brot der Erstlinge, zwanzig Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Sack. Er sagte: „Gib es den Leuten, damit sie essen.“ Sein Diener fragte: „Wie soll ich dies hundert Männern vorsetzen?“ Doch er antwortete: „Gib es den Leuten, damit sie essen, denn so spricht der Herr: Man wird essen und übrig lassen.“
Er setzte es ihnen vor, und sie aßen und ließen übrig, ganz wie es das Wort des Herrn gesagt hatte.
Jetzt folgt gesundes Essen nach den Kolloquinten. Diese Brote, die Erstlingsbrote, waren eigentlich für den Tempel bestimmt. Die Erstlinge mussten ausgesondert und beim nächsten Tempelbesuch abgegeben werden. Doch die zehn Stämme waren vom Tempel im Südreich abgeschnitten.
Der Mann von Ba'al Schalisha gehörte offensichtlich zum Überrest, ähnlich wie bei Elia, als er sagte: „Ich habe mir siebentausend übriggelassen, die dem Baal nicht das Knie beugen.“ Er bringt die gute Nahrung. Diese Brote symbolisieren alle das gesunde Wort Gottes, besonders die Gerstenbrote.
Ich denke an Johannes 6, Vers 9: Ein kleiner Junge hatte Fische und fünf Gerstenbrote. Der Herr Jesus nahm sie, vermehrte sie und sättigte damit die großen Menschenmengen. Später erklärt Jesus: „Ich bin das Brot aus dem Himmel.“
Aufgrund dieser Brotvermehrung erklärte der Herr auch die Bedeutung dieses Zeichens. Dieses Brot weist auf ihn hin. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 51: „Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst“ – das ist ein Aorist im Griechischen, eine punktuelle Handlung – „wer den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit.“
Das zeigt: Wer sich einmal richtig bekehrt, der isst auf ewig gerettet. Man muss sich nicht immer wieder neu bekehren, um errettet zu bleiben. Natürlich soll man sein Leben immer wieder mit dem Herrn in Ordnung bringen, damit die Gemeinschaft – wenn sie getrübt ist – wiederhergestellt wird. Aber wer einmal gerettet ist, wird leben in Ewigkeit.
Die Heilung Naamans und die Versuchung Gehasi
Wir gehen zu Wunder zehn, Kapitel fünf. Naaman, der Heersoberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und sehr angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig.
Es geht um einen syrischen General, der eine große Karriere gemacht hatte und somit von weltgeschichtlicher Bedeutung war. Doch er hat ein Problem: Aussatz, eine schreckliche Krankheit, die von innen heraus beginnt. Irgendeine Stelle fängt an zu erkranken – ein Bild für die Sünde. Wir haben die Sünde als böse Natur von Adam geerbt. Selbst kleine Babys, die so lieblich erscheinen – manche sagen sogar, sie seien Engel – sind keine Engel.
In 1. Mose 4 wird am Schluss berichtet, dass ein Baby geboren wurde und man ihm den Namen Enosch gab, was „böser, sündiger Mensch“ bedeutet. Man wusste schon damals, dass wir Menschen seit Adam ein Problem haben: die Sünde in uns. Wenn die Kinder dann ein bisschen größer werden und „Mama“ und „Papa“ sagen können, freut man sich. Doch plötzlich kommen Worte, die man den Kindern noch nie gesagt hat – und sie verstehen sie.
Der Aussatz bricht aus. Diese Krankheit frisst sich weiter, bis der ganze Körper übersät ist und schließlich zum Tod führt. „Der Lohn der Sünde ist der Tod“, heißt es in Römer 6,23. Naaman hatte eine große Karriere, war aber aussätzig.
Die weiteren Verse zeigen, dass Syrien mit seiner Armee einen Einfall in Israel gemacht hatte. Ein kleines Mädchen wurde als Kriegsgefangene nach Syrien gebracht. Wir kennen das Thema von Geiselnahmen, beispielsweise im Gazastreifen. Dieses Mädchen wurde als Hausmädchen für die Frau des Generals Naaman eingesetzt. Für das Kind war das schrecklich: weg vom Volk Gottes, die ganze Zukunft zerstört, Sklavin im Haus eines feindlichen Generals.
Das Mädchen spricht mit der Frau und sagt, Naaman müsste einmal zu ihrem Propheten gehen. Der könnte ihn heilen. Man hätte erwarten können, dass sie sagt: „Schön, dann wird er sterben.“ Doch sie zeigt eine Lösung auf. Tatsächlich führt das dazu, dass Naaman nach Israel reist und Kontakt mit Elisa sucht, damit dieser ihn heilt.
Elisa geht nicht zu ihm hin. Nach 3. Mose 13,14 ist soziale Distanz bei Aussatz klar vorgeschrieben. Aussätzige mussten sich von Städten fernhalten, außerhalb leben und einen Mundschutz tragen, um Ansteckung zu verhindern. Soziale Distanz war Pflicht. Elisa geht also nicht zu dem General.
Der General ist empört. Er denkt: „Was? Der General von Syrien, ein offizieller Besucher in Israel, und der Prophet kommt nicht mal heraus!“ Das ist nicht vergleichbar mit einem Obersten in Syrien, der einer Frau, die aus Deutschland zu Besuch kommt, nicht die Hand gibt. Die Frau war ja nicht aussätzig. Aber das ist ein anderes Thema.
Hier geht es um den sozialen Abstand zu einem Aussätzigen. Elisa sagt: „Geh und tauche dich siebenmal im Jordan unter.“ Der Mann wird wütend! Er hatte sich eine große Show vorgestellt: Der Prophet kommt heraus, schwingt die Hand über die kranke Stelle und vollbringt eine Zeremonie der Heilung. Doch nichts dergleichen passiert. Nur siebenmal untertauchen.
Er denkt: „Wir haben den Fluss Abana und den Fluss Papa bei Damaskus. Das ist viel besseres Wasser als das Jordanwasser.“ Ob das wirklich so ist, kann man noch überprüfen, aber das war seine Meinung. Ich lese jetzt Vers 12: „Sind nicht Abana und Papa die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden?“ Er wendet sich ab und zieht im Zorn weg.
Manche Menschen verpassen die ewige Rettung, weil sie denken, das Evangelium könne nicht so einfach sein, wie es ist. Es müsse mit einer Show verbunden sein, oder auf eine bestimmte Weise präsentiert werden. Glücklicherweise gibt es aber Menschen, die ermutigen.
Da treten seine Knechte herzu und sprechen zu ihm: „Mein Vater, wenn der Prophet dir etwas Großes gesagt hätte, würdest du es nicht tun? Es ist wirklich so: Manche Menschen würden es toll finden, wenn man ihnen sagt, sie müssten das und das tun, auf den Knien in der Kirche auf- und absteigen, bis die Knie zerschunden sind. Und sie würden es tun. Wie viel mehr dann, wenn dir gesagt wird: Bade dich, und du wirst rein sein!“
Das Evangelium ist viel einfacher. Man muss seine persönliche Schuld Gott bekennen, bereuen und das Opfer des Herrn Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung, in Anspruch nehmen. Der Jordan ist ja der Todesfluss, der ins Tote Meer fließt. Abana und Papa hingegen nicht. Er muss sich im Todesfluss untertauchen, mit Christus sterben und auferstehen. Das ist auch das, was symbolisch in der Taufe zum Ausdruck kommt, nach Römer 6.
Schließlich tut er es: Er steigt hinab und taucht sich siebenmal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er war rein. Er erkennt, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Das ist gewaltig.
Durch dieses Wunder von Elisa wird dieser Mann gesund und auch für die Ewigkeit gerettet. Naaman wollte viel Reichtum als Bezahlung für diese Rettung geben, doch Elisa nahm nichts an. Warum? Weil Rettung nicht bezahlt werden kann.
Nachdem Naaman wieder zurück nach Syrien reisen wollte, ging Gehasi heimlich hinterher und sagte: „Eine kleine Korrektur, ein bisschen etwas wäre schon noch gut.“ Ein Talent Silber, also einige Dutzend Kilogramm, und zwei sehr teure Kleider. Naaman sagte: „Du kannst sogar zwei Talente haben.“
Gehasi, dieser geldgierige Mann, missbrauchte den Namen Gottes (Vers 20) und log in Vers 22. Er legte Naaman damit nahe, dass die Rettung doch etwas koste. Elisa deckt die Sache auf und sagt: „Der Aussatz Nahemanns wird an dir haften und an deinen Nachkommen auf ewig.“ Gehasi ging von ihm hinaus aussätzig wie Schnee.
Das elfte Wunder: Dieser Aussatz kommt auf den Mann, der die Rettung darstellen wollte, aber sie durch Bezahlung missbrauchte. Wenn man die Kirchengeschichte betrachtet, wie viel dort an Messen bezahlt wurde, um angeblich Menschen zu retten, ist das genau der Skandal von Gehasi. Deshalb kommt dieses Zeichen: Der Aussatz kommt auf Gehasi.
Die Vergrößerung der Gemeinde und das schwimmende Eisen
Und jetzt in Kürze, damit wir mit der Zeit wieder halbwegs zurechtkommen, in Kapitel 6:
Die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa: „Sieh doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns dort einen Ort herrichten, um dort zu wohnen.“
Schön, es wächst bei den Propheten, es wird zu eng. Also, sie wohnen in Jericho, in der Stadt des Fluches, und haben nicht mehr genügend Platz. Sie müssen erweitern. Schön, wenn eine Gemeinde sich erweitern und ausbauen muss.
Jetzt gehen sie an den Jordan, also hinaus aus Jericho zum Jordan. Vorher waren sie weit weg vom Jordan, wie man in 2. Könige 2 liest. Sie waren fern, während Elija und Elisa zum Jordan gingen – dorthin, wo später Johannes der Täufer taufen sollte. Heute nennt man das auf Arabisch Kasser al-Yahud, und in der Bibel ist das Betanien, Betanien in der Wüste (Johannes 1).
Dort wollen sie sich neu versammeln und brauchen einen größeren Ort. Jeder soll mithelfen und anpacken, wenn es um einen neuen Ort geht, an dem die Gemeinde mehr Platz hat.
Dann sprach Elisa: „Geht hin!“ Einer sagte: „Lass es dir doch gefallen und geh mit deinen Knechten.“ Er antwortete: „Ich will mitgehen.“ Elisa geht mit – ein Bild des Herrn Jesus, der mitgeht.
Sie gingen an den Jordan und fällten die Bäume. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, dass das Eisen ins Wasser fiel. Er schrie und sprach: „Ach, mein Herr!“ – und es war geliehen.
Der Mann Gottes fragte: „Wohin ist es gefallen?“ Er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt Elisa ein Holz ab, warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Er sagte: „Hol es dir herauf!“ und streckte seine Hand aus und nahm es.
Da konnte einer in große persönliche Bedrängnis kommen. Andere würden sagen: „Nicht so schlimm, kann mal sein, dass eine Axt abfällt.“ Zumindest nicht so schlimm wie in 5. Mose 19, Vers 5, wo eine Axt bei der Arbeit jemand am Kopf trifft und ihn tötet. War das Mord oder Totschlag? Da kommt man in Bedrängnis.
Hier aber fällt das Eisen ins Wasser, jetzt ist es halt weg in den Todesfluss. Und es war geliehen. Alle Mittel, die der Herr uns zum Gemeindebau gibt, sind eigentlich geliehen. Wir können nicht sagen: „Ich bin stolz auf meine Gaben, weil ich sie gemacht habe.“
1. Korinther 4 sagt: „Was hast du, das du nicht empfangen hast?“ Wir können auf keine Gaben stolz sein, es ist alles ein Geschenk, alles Gnade.
Nun fiel das Eisen ins Wasser, ins Todeswasser. Elisa wirft ein Holz hinein, es schwimmt und bringt das Eisen wieder hoch. Das erinnert an 2. Mose 15,25: Bitteres Wasser für die Israeliten, und Mose nimmt ein Holz, wirft es hinein und das Wasser wird süß.
Das Kreuz des Herrn Jesus wird in Galater 3 das Holz genannt: „Verflucht ist jeder, der am Holze hängt.“ Durch das Holz wird das Bittere im Leben süß (2. Mose 15).
Durch das Holz, durch das Kreuz, wird das, was wir brauchen, um dem Herrn zu dienen, aus dem Tod herausgeholt und uns geschenkt – auf der Grundlage, dass Jesus eben gestorben und auferstanden ist.
Die syrische Armee und die Blindheit
Im nächsten Abschnitt will der König von Syrien Krieg gegen Israel führen. Dabei hat er es besonders auf den König Israels abgesehen. Elisa kann dem König jedoch immer wieder sagen: „Pass auf, die Syrer werden dort kommen“, oder „Nein, sie werden dort angreifen.“ Jedes Mal sind die Syrer überrascht, obwohl sie einen Kriegsplan haben. Offensichtlich wird dieser Plan ständig verraten. Deshalb fragt der König von Syrien seinen Vertrauten: „Gibt es jemanden unter uns, der die Pläne verrät?“
Das erinnert an die Situation in Gaza, wo es Leute gibt, die Informationen weitergeben, und der Geheimdienst davon weiß. So wissen die Gegner genau, wohin sie gehen müssen und was sie erreichen wollen. Der syrische König vermutet also, dass jemand aus seiner Armee alles verrät. Es gibt jedoch keinen Spion. Einer aus der syrischen Armee sagt dem König: „Nein, der Schuldige ist Elisa. Er weiß durch den wahren Gott immer, wo was ist.“
Wo befindet sich dieser Elisa? In Dothan. Dies kennen wir aus der Josef-Geschichte. Josef ging nach Dothan zu seinen Brüdern, und dort wurde er in einen Brunnen geworfen. Dothan liegt übrigens ganz in der Nähe von Jenin. Dort kann man noch den Tell, also den Hügel der alten Stadt Dothan, sehen. Um diese Stadt geht es hier.
In Dothan gibt es zwei Brunnen, die nebeneinander liegen. In 1. Mose 37 wird erzählt, dass Josef in eine der Gruben geworfen wurde, die ohne Wasser war. Es gibt dort tatsächlich zwei Brunnen, und das Wort Dothan bedeutet „Doppelbrunnen“.
Ich habe dort auch eine besondere Erfahrung gemacht. Ich war mit einer Gruppe bei den Brunnen, als ein Palästinenser mit seinem Auto kam. Er wollte mit mir sprechen und sprach mich immer wieder auf Hebräisch an, obwohl ich kein Wort Hebräisch sprach. Er versuchte offenbar herauszufinden, ob ich Israeli bin. Ich antwortete ihm nur auf Englisch. Das war in der Nähe von Jenin, einer Hochburg des Terrorismus. Die Situation hätte also sehr gefährlich enden können.
Solche persönlichen Erfahrungen kommen mir in den Sinn, wenn ich den Namen Dothan lese – zusammen mit der Geschichte von Josef und meiner eigenen Begegnung dort.
Die syrische Armee zieht also nach Dothan. Durch Elisas Gebet bewirkt der Herr, dass die Augen der Soldaten geblendet werden. Elisa betet: „Herr, tu doch ihre Augen zu.“
Wir müssen jedoch zuerst die Verse 14 bis 16 lesen, in denen die Armee nach Dothan kommt und Elisas Diener Angst bekommt. Dann folgt Vers 17, wo ein besonderes Wunder geschieht: Elisa betet und sagt: „Herr, tu doch seine Augen auf, dass er sehe.“ Da öffnet der Herr die Augen des Knaben, und er sieht, dass der Berg voll feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa ist.
Die geöffneten Augen des Dieners zeigen die himmlischen Heerscharen. Elisa selbst musste seine Augen nicht öffnen, denn ihm war klar, dass unzählige Engel da waren, um sie zu beschützen.
Auch ich habe diese Erfahrung in Dothan gemacht. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 26, als er in Gethsemane verhaftet wurde, dass er den Vater hätte bitten können, ihm zwölf Legionen Engel zu schicken – insgesamt 72 Engel –, die zur Verfügung stehen.
In 1. Mose 32 war Jakob mit seiner Familie in großer Bedrängnis, doch er durfte erleben, dass zwei Heerlager von Engeln da waren. Im Psalm 34, Vers 8, lesen wir vom Engel des Herrn, der die Gläubigen schützt.
Nun bittet Elisa, dass dem Knaben die Augen geöffnet werden, damit er sieht. Der Herr setzt seine ganze Macht für die Erlösten ein, wenn sie in Gefahr sind.
Die syrische Armee wird geblendet und freundlich entlassen
Und jetzt zum vierzehnten Wunder. Wir haben es gleich.
Sie kam zu ihm herab, und Elisa betete zu dem Herrn und sprach: „Schlage doch dieses Volk mit Blindheit.“ Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas.
Elisa sprach zu ihnen: „Dies ist nicht der Weg, und dies ist nicht die Stadt. Folgt mir, und ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht.“ Die Syrer waren mit Blindheit geschlagen und realisierten nicht mehr, ob sie wirklich in Dothan waren oder nicht.
Elisa sagte, dass sie eigentlich den König von Israel suchten. Den wollten sie ja, aber Elisa hatte das alles verhindert. Also zeigte er ihnen den Mann, den sie suchten, und führte die ganze Armee nach Samaria. Dothan und Samaria liegen beide im heutigen sogenannten Westjordanland.
Dort, in Samaria angekommen, bat Elisa im Vers 20: „Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa: Herr, tu diesen die Augen auf, dass sie sehen.“ Da tat der Herr ihnen die Augen auf, dass sie sehen konnten, und sie sahen, und siehe, sie waren mitten in Samaria.
Dorthin gehe ich auch gerne mit Israelgruppen – mitten in Samaria. Und genau dort waren sie.
Dann, im Vers 21, sprach der König von Israel zu Elisa, als er sie sah: „Soll ich sie schlagen, mein Vater?“ Aber Elisa antwortete: „Du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast?“
Nein, Kriegsgefangene behandelt man gut. Man schlachtet sie nicht einfach ab. Diese waren jetzt da, er hatte sie von Dothan gebracht, und sie waren wie Kriegsgefangene. Mit denen geht man nicht mit Gewalt um.
Elisa sagte: „Setze ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken, und dann ziehen sie zu ihrem Herrn.“ Der König bereitete ihnen ein großes Mahl, und sie aßen und tranken. Danach entließ er sie, und sie zogen zu ihrem Herrn.
Seitdem kamen die Streifscharen der Syrer nicht mehr in das Land Israel. Es herrschte für einige Zeit Ruhe.
Nach einiger Zeit kamen sie dann wieder, aber es gab zweimal Ruhe, mit Güte. Das ist genau so, wie es in Sprüche 25,21-22 heißt: „Wenn dein Feind hungert, speise ihn; wenn er dürstet, tränke ihn, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, und der Herr wird dir vergelten.“
Dieser Vers wird auch in Römer 12 zitiert, um uns zu zeigen, wie wir mit Feinden umgehen sollen – mit Liebe.
Ist das nicht fantastisch? Sie bekamen alle noch ein Essen in Samaria und wurden dann nach Hause entlassen.
Ich habe in Samaria auch einmal ein Essen bekommen, ganz privat mit meiner Frau zusammen. Wow, was die uns da aufgetischt haben! Das war wirklich vom Edelsten – arabisches Essen.
Ich erinnere mich ganz genau an dieses Essen, das diese Syrer in Samaria bekommen hatten. Danach gingen sie nach Hause, und es war Frieden – zumindest für eine Zeit.
Diese Liebe zu den Feinden, wie sie in Matthäus 5,43-44 gelehrt wird, wurde hier alttestamentlich praktiziert und umgesetzt.
Die Auferstehung durch den Tod Elisas
Und dann bleibt noch das letzte Zeichen, aber das haben wir ja schon besprochen. Ich lese darum nur noch Kapitel 13, Vers 20: Elisa starb, und man begrub ihn.
Es kamen Streifscharen der Moabiter ins Land, als das Jahr anfing. Es geschah, als sie einen Mann begruben, dass sie die Streifschar sahen. Sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er eher lebendig und erhob sich auf seine Füße.
Das sechste Wunder: Er ist schon tot, aber sein Tod ist immer noch zum Segen. So wie es in den Sprüchen heißt: Das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen.
Wie geht das? Nun, in Hebräer 13 lesen wir: Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Dort wird aufgerufen, dass wir ihren Glauben nachahmen sollen.
So wirkt jemand, der dem Herrn gedient hat, als Mann Gottes oder als Frau Gottes, eben zum Segen der nachfolgenden Generationen. Wenn man sich an sie erinnert, ist das Gedächtnis des Gerechten zum Segen.
Typischerweise schreibt man das auf Gräber in Israel mit einer Abkürzung: „s“ und „l“ mit einem Strichlein dazwischen. Die Abkürzung steht für „Sichrono Livracha“ – das Gedächtnis an ihn möge zum Segen sein.
So war eben Elisa zum Segen, sogar über seinen Tod hinaus. Das ist wieder ein Hinweis auf Tod und Auferstehung, die eben nur der wahre Gott bewirken kann.
Danke für die Geduld wegen der Überzeit.
Vielen Dank an Roger Liebi, dass wir seine Ressourcen hier zur Verfügung stellen dürfen!
Noch mehr Inhalte von Roger Liebi gibt es auf seiner Webseite unter rogerliebi.ch