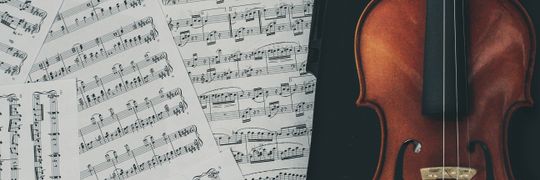Ich möchte alle ganz herzlich zu diesem Bibelstudientag begrüßen. Das Thema ist sehr wichtig und aktuell: Ist Musik neutral? Die Überfremdung der christlichen Gemeinden durch heidnische Musik.
Auf der Einladung wurde das Thema folgendermaßen angekündigt: Mit dem Argument, Musik sei grundsätzlich neutral, wurde in den vergangenen Jahren der atemrhythmische christliche Gesang weltweit in Abertausenden von Gemeinden durch eine von Pop und Rock inspirierte motorisch-rhythmische Musik ersetzt.
Aus biblischer, musikwissenschaftlicher und künstlerischer Sicht beschäftigen wir uns unter anderem mit folgenden Fragen: Gibt es christliche Musik? Warum ist motorische Rhythmik wieder natürlich und heidnisch? Wie wirkt Atemrhythmik und wie motorische Rhythmik?
Ursprung und Entwicklung der christlichen Musik
In einem ersten Teil beschäftigen wir uns mit dem geschichtlichen Aspekt vom Tempel zur Urgemeinde. Die jüdische Musik des Tempels und der Synagoge aus dem Alten Testament bildet nämlich die Grundlage der christlichen Musik im Neuen Testament. Die frühen Christen haben die Musik des Volkes Israel in ihren Gemeinden übernommen.
Diese Musik, die man im Tempel und in den Synagogen sang, ist hier auf dem Bild am ersten Bibelvers zu sehen. Im Hebräischen schreibt man nur die Konsonanten. Wer Hebräisch kann, kann den Text auch ohne Vokalangaben lesen. Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim ve et ha-Aretz – Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.
Im Mittelalter fügten die Rabbiner Punkte und Striche hinzu, um die Vokale anzuzeigen. Das war besonders für diejenigen wichtig, die sonst nicht lesen konnten. Doch sie taten noch mehr: Sie setzten auch Kadenzzeichen ein. Man sieht hier diesen Schrägstrich bei „Bereshit“. Das ist kein Vokal, sondern ein Hinweis auf einen Ton. Beim nächsten Wort sieht man Ecken, die ebenfalls eine Angabe dazu sind, wie man das singen muss.
So wurde in den Synagogen beim Vorlesen der Bibel im Alten Testament – und das gilt bis heute – der Text nicht einfach nur gelesen: „Bereshit, Bara, Elohim“. Der Chasan musste den Text singen. Dabei orientierte er sich an diesen Zeichen, die heute neu gedeutet werden können.
Diese Deutung ist das Werk der jüdischen Komponistin und Organistin Suzanne Aykventura. Ähnlich wie Jean Poulion die ägyptischen Hieroglyphen wieder entziffern konnte, gelang es ihr, die Kadenzzeichen in ihrer ursprünglichen Bedeutung zu verstehen.
Ab dem zweiten Tempel, der im Jahr 70 zerstört wurde, ging die genaue Bedeutung dieser Handzeichen verloren. Deshalb singen Juden in Polen anders als Juden in Marokko, und die Juden in Marokko singen wiederum anders als die im Iran. Die Juden im Jemen haben ebenfalls eine andere Gesangstradition.
Die ursprüngliche Bedeutung wäre jedoch diese Melodie: „Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim ve et ha-Aretz“. Diese Melodie entsteht, wenn man die Zeichen richtig einsetzt. So ist das ganze Alte Testament beziffert. Jedes Wort beziehungsweise jede Wortverbindung ist mit solchen Zeichen versehen.
Man könnte diese Melodie natürlich auch vierstimmig ausstatten.
Die Musik der ersten Christen und ihre Ausbreitung in Europa
War die Musik der ersten Christen?
Hier sehen wir den Tempelplatz in Jerusalem. Der Pfeil zeigt auf die Ostmauer. Entlang der Ostmauer war die Säulenhalle Salomos gebaut. Apostelgeschichte 5,12 berichtet uns davon, wie die ersten Christen ab dem Pfingsttag dort jeden Tag zusammenkamen. Tausende von Juden, die sich zum Messias Jesus bekehrt hatten, versammelten sich dort täglich. Sie wurden von den Aposteln im Tempel unterwiesen, wie es hier heißt. Sie waren einmütig beieinander in der Säulenhalle Salomos.
Diese Halle war etwa zweihundertfünfzig Meter lang und mit wunderbaren Säulen und Zederndecken ausgestattet – also ganz großartig. Und das Beste: Es gab keinen Mietpreis, die Nutzung war gratis. So kamen sie zusammen. Aber was sangen diese frühen Christen? Natürlich die gleichen Lieder, die man schon im Tempel sang – die alttestamentlichen Lieder und Psalmen. Doch es wurden nicht nur die Psalmen gesungen, sondern eigentlich das ganze Alte Testament.
Jesus Christus gab seinen Jüngern den Auftrag, das Evangelium bis an das Ende der Erde zu verbreiten (Apostelgeschichte 1,8). So kamen die frühen Christen mit dem Evangelium schon im ersten Jahrhundert nicht nur in Asien und Afrika an, sondern auch nach Europa. Besonders die Apostelgeschichte berichtet davon, ab Kapitel 16, wo Paulus auf seiner dritten Missionsreise nach Europa kommt und Gemeinde um Gemeinde gründet: zuerst Philippi, dann Thessalonich, weiter über Beröa nach Athen und schließlich nach Korinth.
Was sangen diese ersten Christen in Europa? Die jüdische Musik verdrängte dort die heidnische Musik der Römer und Griechen. Die frühen Christen übernahmen die gleichen Gesänge. Besonders interessant ist Apostelgeschichte 16, wo Paulus die erste Stadt in Europa evangelisiert. Er kam mit Silas ins Gefängnis. Dort wurden sie wundgeschlagen und hatten die Beine im Stock gebunden (Apostelgeschichte 16,25).
Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder – im Griechischen „hymneo“. Das bedeutet, ein Loblied zur Anbetung Gottes zu singen. In Matthäus 26,30 wird berichtet, dass der Herr nach dem Passamahl mit den Jüngern ein Loblied gesungen hatte, bevor er in den Garten Gethsemane ging. Dieser Ausdruck bezeichnet dort den Schluss der Psalmen, die man bei der Passafeier in der Familie sang, nämlich Psalm 113 bis 118. So hat der Herr mit seinen Jüngern noch aus der Bibel gesungen, bevor er weiterging.
Als Paulus und Silas nach Europa kamen, lobten sie Gott im Gefängnis. Sie übernahmen nicht plötzlich neue Lieder von den Römern, sondern blieben ihrer jüdischen Art treu. Interessanterweise hörten die Gefangenen ihnen zu, obwohl der Gesang an Gott gerichtet war. Das hatte eine evangelistische Wirkung auf sie.
In der weiteren Geschichte sehen wir, wie der Kerkermeister dadurch vorbereitet wurde. Als ein Erdbeben kam und die Gefangenen hätten fliehen können, wollte er sich umbringen. Nach römischem Recht stand die Todesstrafe auf das Entkommen von Gefangenen. Doch Paulus hinderte ihn daran. Der Kerkermeister fragte: „Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden?“ Wie kam ein Heide aus Europa, der nichts vom Evangelium wusste, auf diese Frage? Offensichtlich hatte er etwas mitbekommen, auch durch das Singen von Paulus und Silas.
Die Antwort lautete: Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus errettet werden. So übernahmen die frühen Christen in Europa auch diese Lieder.
Reflexion über die geschichtliche Entwicklung der Musik in der Kirche
Und jetzt wollen wir zwischendurch darüber nachdenken, was wir geschichtlich gesehen haben. Erstens: Weshalb übernahmen die frühen Christen nicht die Musik der römischen Kultur? Man hätte ja denken können, Paulus hätte eine Missionsstrategie entwickelt, die bedeutet, kontextuell zu evangelisieren. Das heißt, wenn man in eine andere Kultur geht, schaut man, dass man möglichst diese Kultur für die Gemeinden übernehmen kann.
Aber was die Musik anbetrifft, wurde die römische Musik verdrängt. Das führte dazu, dass im ersten Jahrhundert die Christen zwar noch eine kleine Minderheit in Europa waren, sich aber in den folgenden Jahrhunderten die griechisch-römische Musik weitgehend aus Europa zurückzog und durch christliche Musik ersetzt wurde.
Im vierten und fünften Jahrhundert, als das Christentum Staatsreligion wurde, wurde die heidnische Musik an den Rand gedrängt. Die christliche Musik bildete den Ausgangspunkt für die gesamte weitere Entwicklung der Musik in Europa. Diese christliche Musik war jedoch jüdisch-christlich geprägt.
Die Antwort darauf ist, dass sich die Christen von der Musik der Heiden distanzierten. Diese Musik wurde unter anderem bei ausgelassenen Festen und ekstatischen Kulten verwendet. Das wollten sie nicht übernehmen oder christianisieren. Das sind geschichtliche Fakten, die vielen nicht bekannt sind.
Ich selbst wurde zum ersten Mal damit vertraut durch meinen Lehrer am Konservatorium, der mir Tonsatz, also Harmonielehre und Kontrapunkt, als Werkzeuge für Komposition beibrachte. Dieser Lehrer war der israelische Komponist Yehoshua Lackner, einer der großen Komponisten des zwanzigsten Jahrhunderts aus Israel.
Von ihm habe ich gelernt, dass die frühchristliche Musik auf jüdischer Musik basiert. Das konnte man auch nachweisen durch Übereinstimmungen von Melodien der jüdischen Gemeinden im Jemen mit den Melodien der frühen Christen. Jemen und Europa hatten keine kulturellen Beziehungen. Die Parallelen ergaben sich dadurch, dass sowohl die jemenitischen Juden als auch die frühen Christen in Europa die gleiche Quelle für ihre Musik hatten – nämlich den Tempel und die Synagogen in Israel.
Moderne Verdrängung der Musikstile und deren Auswirkungen
Eine zweite Frage zum Nachdenken: Verdrängung von bestehender Musik durch eine andere Art von Musik – kennen wir das auch in unserer Zeit?
Die Antwort ist zweifach.
Erstens: Die moderne afroamerikanische Musik verdrängte im zwanzigsten Jahrhundert die herkömmliche europäische Musik, also Klassik und Ähnliches. Diese Entwicklung begann mit der Entstehung des Jazz um 1890. Doch bis der Jazz eine weite Verbreitung erlebte, vergingen noch viele Jahrzehnte. Im zwanzigsten Jahrhundert fand diese Verdrängung jedoch sehr erfolgreich statt.
Wenn man im Radio einen Sender nach dem anderen anklickt, hört man nicht mehr europäische Musik, sondern afroamerikanische Musik. Man kann sie auch als moderne Musik bezeichnen, oder als Pop- und Rockmusik – wie man will. Zusammengefasst lässt sich diese Musikform gut als afroamerikanische Musik bezeichnen. Sie hat im zwanzigsten Jahrhundert die herkömmliche Musik weitgehend verdrängt.
Fragt man junge Leute, welche Musik sie hören, antworten praktisch alle, dass sie afroamerikanische Musik hören – nicht mehr die herkömmliche Musik aus Europa.
Zweitens: Die moderne afroamerikanische Worship-Musik verdrängte in den vergangenen Jahrzehnten die herkömmlichen christlichen Choräle und Lieder in den Gemeinden. Dies geschah ganz eindrücklich.
Eine Zeit lang führte man in vielen Gemeinden beide Stilarten nebeneinander. Doch Rick Warren schreibt in seinem Buch, das weltweit Gemeinden beeinflusst hat, The Purpose Driven Church (auf Deutsch: Kirche mit Vision oder Gemeinde mit Vision), dass dies ein Fehler war. In der Saddleback-Gemeinde hatte man früher beide Stilarten nebeneinander verwendet. Er erkannte, dass dies falsch war, denn es frustrierte alle – sowohl die, die Choräle liebten, als auch diejenigen, die die moderne Musik bevorzugten.
Man müsse sich für einen Stil entscheiden. Sie entschieden sich für Pop- und Rockmusik, sagte er, und daraufhin wuchs die Gemeinde explosionsartig. Saddleback wurde eine Vorbildgemeinde weltweit für Abertausende von Gemeinden, die es ebenfalls so machten.
Wir kennen dieses Phänomen also auch in unserer Zeit – in der Zeit, die die Bibel als Endzeit bezeichnet. Das ist die Zeit, in der Jesus Christus bald wieder zurückkehren wird, das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung heimkehrt, den Staat Israel wieder gründet, die Wüste aufblüht und Hebräisch wieder gesprochen wird.
In der Endzeit findet auch in Europa wieder eine Verdrängung der bestehenden Musik durch eine neue Musik statt – so wie es bereits in der Anfangszeit nach dem ersten Kommen von Jesus Christus geschah. Damals verdrängte die jüdisch-christliche Musik die heidnische Musik.
In unserer Zeit geschieht das Gleiche, aber umgekehrt: Eine heidnische Musik hat die christliche Musik an den Rand gedrängt beziehungsweise verdrängt.
Charakteristik und Wirkung der motorischen Rhythmik in der Musik
Warum spreche ich von heidnischer Musik? Die afroamerikanische Musik ist geprägt durch motorische Rhythmusschläge. Das bedeutet, dass im Takt – beispielsweise im Viervierteltakt – die Schläge eins, zwei, drei, vier jeweils genau gleich lang sind, ohne Variation.
Dies steht im grundsätzlichen Gegensatz zur Musik in Europa und zur Musik im Alten Testament. Dort ändern sich nämlich die Längen der Viertelschläge, der Grundschläge. In Afrika hingegen hat man von alters her festgestellt, dass das Trommeln mit stets gleichbleibenden Grundschlägen eine berauschende Wirkung hat.
Wenn man so in Trance, in Ekstase, in Berauschung gerät, kann man Kontakt zur unsichtbaren Welt aufnehmen – zu Geistern und Dämonen. Deshalb spielt diese motorische Rhythmik in Afrika eine so grundlegende Rolle. Die afrikanischen Stämme unterscheiden nicht zwischen Religion und Alltag. Alles ist geprägt von ihrer Religion und ihrem Geisterkult.
Daher prägt auch diese Musik, bei der jeder Schlag immer genau gleich ist, die gesamte Kultur – sogar das Arbeiten. Das ist ein ganz grundlegender Unterschied. Ich möchte das kurz verdeutlichen, obwohl eigentlich jeder weiß, wie das klingt: Jeder Schlag ist genau gleich. Zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, und so weiter. Dazu wird musiziert und gesungen.
Alle Melodien müssen sich genau in dieses unveränderte Rhythmusmuster vom Grundschlag her einordnen. Doch das führt nach kurzer Zeit dazu, dass das Gehirn bestimmte Funktionen fallen lässt, dass einige Gehirnregionen nicht mehr arbeiten. Man kann sagen: Motorisch rhythmische Trommelschläge schränken den Wachzustand des Gehirns ein und fahren ihn herunter.
Daraus entsteht Trance und Rausch. Man ist zwar weiterhin anwesend, aber gewisse Regionen, zum Beispiel der Parietallappen, der für das Empfinden von Zeit und Raum zuständig ist, werden heruntergefahren.
Ähnliches erlebt man in der tibetischen buddhistischen Meditation. Mönche, die diese Meditation praktizieren, haben das Gefühl, eins mit der Umwelt zu sein und dass die Zeit aufhört zu existieren – es sei wie das Nirwana. Doch das ist nur eine Einbildung, weil das Gehirn das Gefühl für Zeit, Raum und die Distanz zwischen Ich, Körper und Umwelt herunterfährt. So entsteht das Gefühl, eins mit der Umwelt zu sein.
So entstehen Trance und Rausch. Die Wahrnehmung von Zeit und Raum nimmt ab, die Körperkontrolle wird reduziert, und die Denkabläufe werden geschwächt. Das heißt, zum Beispiel wird das kritische Denken heruntergefahren. Deshalb ist man unter dem Einfluss dieser Musik leichter beeinflussbar, übernimmt schneller auch seltsame Ideen, und es entstehen Glücksgefühle.
Diese Parallelen bestehen auch zu Drogen. Bei Drogen werden ebenfalls bestimmte Gehirnregionen heruntergefahren, bis hin zur Ausschaltung. Natürlich gibt es Abstufungen – von wenig Wirkung über stärkere bis zu extremen Zuständen. Bei der Musik ist es genauso. Es hängt davon ab, wie lange man unter ihrem Einfluss steht und wie sehr man sich innerlich der Musik öffnet und hingibt. Das spielt eine wichtige Rolle.
Man muss also sagen: Diese motorischen Rhythmusschläge sind typisch für die heidnische, vom Dämonenkult geprägte Musik Schwarzafrikas. Ähnliche Muster finden sich auch in vielen anderen Stammeskulturen weltweit – in Asien und bei den Indianern zum Beispiel. Sie haben dasselbe herausgefunden.
Rausch und Trance lassen sich also nicht nur durch Drogen und Alkohol erreichen, sondern auch durch motorische Rhythmusschläge.
Entstehung afroamerikanischer Musikstile und deren Einfluss
Die schwarzen Sklaven brachten die motorische Rhythmik des heidnischen Afrikas nach Amerika. Als dann die Sklaverei abgeschafft wurde, mussten sich viele ehemalige Sklaven überlegen, was sie nun arbeiten könnten. Viele begannen als Straßenmusiker zu arbeiten, spielten in Bars und an anderen Orten.
Dabei nutzten sie die Rhythmik Afrikas und lernten von den Weißen in Amerika, wie man Melodien nach deren Art singt und Akkorde für Harmonien verwendet. So entstand der Jazz. Um 1890 entstand der Jazz, und ungefähr alle zehn Jahre entwickelte sich ein neuer Stil. Daher lässt sich die Jazzgeschichte gut in Zehnjahresperioden einteilen.
In den 1940er Jahren wurde ein Stil besonders populär, den man Rhythm and Blues nennt. Dieser war vor allem bei den Schwarzen in Amerika beliebt, weniger bei den Weißen. Dann kam jemand auf die Idee, Rhythm and Blues mit der Musik der weißen Amerikaner, der Country-Musik, zu verbinden. Diese Mischung aus afrikanischen motorischen Rhythmen und europäischen Melodien, die auch den Weißen gefielen, führte zu einer neuen Musikrichtung.
Im Jazz hatte man zwar bereits europäische Melodik übernommen, diese aber afrikanisch angepasst. Doch nun wurden wirklich Melodien der Weißen mit afrikanischen Rhythmen gemischt, was eine ganz neue Art von Musik ergab. Schon früh erhielt diese Musik den Namen „Rock'n'Roll“. Diese Musik entstand 1953.
Der Begriff Rock and Roll stammt aus dem Ghetto der Schwarzen in Amerika und bedeutete so viel wie Unzucht oder Hurerei. Man bemerkte, dass diese Musik in diese Richtung zog, ohne es genau erklären zu können.
Wenn man die Geschichte von 1953 bis 2012 betrachtet, entwickelten sich aus dem Rock'n'Roll unzählige neue moderne Stile. Dazu gehören Hardrock, Heavy Metal, Softrock, Soul, Punk, Jazzrock, Psychedelic Rock, Barockrock, Funk, Techno, House, Philly, Reggae, Folk, Beat, Surf, Disco und viele mehr. Auch christliche Worship-Musik oder charismatische Anbetungslieder gehen in ihrer Entwicklung auf den Rock'n'Roll mit seinem motorischen Grundbeat zurück, der unverändert bleibt.
Biblische Perspektive auf Nüchternheit und Musik
Nun, warum muss man das ablehnen?
Gerade vor kurzem hat mir jemand eine E-Mail geschrieben und sehr eindringlich gefragt: Warum lehnen Sie die motorische Rhythmik so grundsätzlich ab?
In 2. Timotheus 4,5 sagt der Apostel Paulus zu Timotheus: „Du aber sei nüchtern in allem.“ Das mit „nüchtern sein“ übersetzte Verb nepho im Griechischen bedeutet gemäß dem Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer: frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung und Exaltiertheit.
Und das kommt nicht nur einmal vor. An dieser Stelle habe ich gleich alle elf Stellen im Neuen Testament zusammengestellt, die die Gläubigen zur Nüchternheit aufrufen. Zum Beispiel 1. Korinther 15,34; 1. Thessalonicher 5,6.8 und so weiter – elfmal eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang.
Auch 1. Petrus 4,7: „Es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge; seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet.“ Interessant ist, dass das gerade in Verbindung mit dem Gebet gesagt wird. Und das ist nicht nur eine Empfehlung, sondern ein Gebot Gottes: „Du aber sei nüchtern in allem“, also sei frei von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, frei von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung und Exaltiertheit.
Aber wir sehen, seit diese moderne Musik in die Gemeinden gekommen ist – in den vergangenen Jahrzehnten, gerade im Zusammenhang mit der charismatischen Bewegung – ist es üblich geworden, dass man in sogenannten Worship-Zeiten richtig „abhebt“. Man braucht eben diese Rhythmik, das funktioniert nicht mit Vivaldi. Das geht nicht, wir werden gleich noch sehen, warum. Wir können das ganz genau erklären.
Um diese Art von Gefühlen und Berauschung zu erleben, braucht es diesen motorischen Rhythmus.
Aber man muss hier ganz grundsätzlich sagen: Hier versündigt man sich gegen Gott, denn man bricht ein Gebot, das die Bibel elfmal so ausdrücklich nennt: „Du aber sei nüchtern in allem“, frei von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit. So wird dieses Wort im griechischen Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer erklärt.
Beispiele aus dem Alten Testament zur missbräuchlichen Musik
Wir sehen bereits im Alten Testament, wie Musik missbraucht werden konnte und unter dem Einfluss des Bösen stand. Als Mose länger auf dem Berg blieb, um die Gesetzestafeln abzuholen, wurde das Volk ungeduldig und führte die Verehrung des goldenen Kalbes ein. Zu diesem Anlass wurde ein Fest veranstaltet.
In 2. Mose 32,17 lesen wir, wie Joshua, der zusammen mit Mose auf dem Berg war, die Musik hörte: „Und Joshua hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte, und sprach zu Mose: Kriegsgeschrei ist im Lager.“ Mose antwortete: „Es ist nicht der Schall von Siegesschrei und nicht der Schall von Geschrei der Niederlage, den Schall von Wechselgesang höre ich.“ Mose erkannte also, dass es nicht Kriegsmusik im eigentlichen Sinne war, obwohl es so klang.
Was ist typisch für Kriegsmusik? Seit alters her wird dort motorische Rhythmik verwendet, um die Angst vor dem Töten abzubauen. Das Gehirn wird dabei sozusagen heruntergefahren, sodass der Soldat die natürliche Angst vor dem Töten eines anderen Menschen verringern kann.
Joshua sagte jedoch nicht: „Mose, schau mal, das klingt wie damals, als wir durchs Rote Meer gegangen sind und das Lied der Erlösung gesungen haben“ (2. Mose 15). Nein, er meinte, es sei Kriegsgeschrei. Es handelte sich um eine ganz andere Art des Singens und Musizierens – motorischer Rhythmus und nicht Atemrhythmus.
Schauen wir, was zuvor in 2. Mose 32,5 steht: „Und als Aaron es sah, das goldene Kalb, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sprach: Ein Fest dem Herrn ist morgen.“ Sie sagten also nicht, dass sie den Gott Israels aufgeben. Vielmehr sollte das Ganze eine Feier zu Ehren des Herrn sein. Hier wird Yahweh, der Name des Bundesgottes Israels, genannt.
Am folgenden Tag standen sie früh auf, opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer dar – Opfer, die von der Anbetung Gottes zeugen. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand dann auf, um sich in Ausgelassenheit zu verlieren.
Hier sehen wir deutlich, dass Worship mit Ausgelassenheit verbunden war, die durch diese motorische Rhythmik bewirkt wurde.
Biblische Grundlage für die Verwendung jüdischer Musik in den Gemeinden
Nun sind wir immer noch beim Thema „Vom Tempel zur Urgemeinde: Wie die Musik aus Israel nach Europa kam“.
In Römer 15 spricht der Apostel Paulus über seinen Auftrag, das Evangelium unter den Völkern zu verkündigen, die noch nie erreicht worden sind. In diesem Zusammenhang sagt er in Vers 9: „Damit die Heiden aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Psalmen singen.“
Hier wird aus Psalm 18 zitiert, um zu verdeutlichen: In den Psalmen wird gesagt, dass der Psalmist Gottes Namen unter den heidnischen Nationen bekennen wird. Unter diesen Nationen wird er Gott Psalmen singen, also Lieder aus dem Alten Testament.
Das Wort für „Psalmen singen“ heißt im Griechischen „psallo“. Es hat grundsätzlich drei Bedeutungen. Die ursprüngliche Bedeutung ist „das Zupfen einer Saite“, also das Spielen eines Instruments. Danach bekam es die zweite Bedeutung: „ein Lied oder einen Psalm mit einem Saiteninstrument begleiten“. Schließlich konnte „psallo“ sogar einfach für „Singen“ gebraucht werden, auch wenn kein Instrument vorhanden war.
Römer 15,9 spricht also ganz klar davon, dass die jüdische Musik, die Psalmen, unter den Nationen gesungen werden sollten. Dies war die biblische Rechtfertigung dafür, dass die jüdische Musik auch in die Gemeinden unter den heidnischen Völkern hineingebracht werden sollte.
Musik und Geistliche Erfüllung im Neuen Testament
In Epheser 5,18 finden wir erneut eine Stelle, die den frühchristlichen Gesang behandelt. Die Gemeinde in Ephesus, gelegen in der heutigen Westtürkei, bestand hauptsächlich oder zu einem großen Teil aus Heiden, also Menschen ohne jüdische Herkunft.
Paulus sagt dort: „Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr zueinander redet in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn mit eurem Herzen, dankend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“
Das Erste, was Paulus betont, ist, sich fernzuhalten von Berauschung, wie sie die Heiden oft im Zusammenhang mit ihrer Musik erlebten. Ich sage es jetzt mit meinen Worten: Wenn man sich berauscht, fährt das Gehirn herunter. Dadurch entsteht Ausschweifung, weil etwa der Stirnlappen, der Hirnteil ganz vorne hinter der Stirn, der für Selbstkontrolle, Organisation und Planung zuständig ist, heruntergefahren wird.
Deshalb verliert man beim übermäßigen Weintrinken die Selbstkontrolle. Gott verbietet dieses Herunterfahren. Er sagt: „Berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist.“ Stattdessen kommt der Gegensatz: „Werdet mit dem Geist erfüllt.“
Manche haben die Idee, dass dies bedeutet, man solle eine Berauschung durch den Heiligen Geist erleben. Das ist jedoch gerade der Kontrast zur Berauschung. Denn der Heilige Geist wird in 2. Timotheus 1,7 als Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit bezeichnet. Das griechische Wort für Besonnenheit bedeutet auch Selbstkontrolle.
Der Heilige Geist ist also ein Geist der Selbstkontrolle. Er hilft uns, unseren Frontallappen besser zu gebrauchen, also den Bereich im Gehirn, der für Planung und Selbstkontrolle zuständig ist. Paulus fordert uns auf: „Werdet mit dem Geist erfüllt.“
Wie aber wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt? Das geht nur, wenn Sünde in unserem Leben keinen Platz hat. In Epheser 4,30 heißt es: „Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid.“ Dort wird erklärt, dass Zorn, Wut, Geschrei, Bosheit und Nichtvergebungsbereitschaft abgelegt werden sollen.
Wir können mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn wir diese sündhaften Dinge bekennen, hinauswerfen und die Vergebung und Reinigung dafür annehmen. Dann sind wir bereit, mit dem Geist erfüllt zu sein.
Was geschieht dann? Paulus sagt: „Indem ihr zueinander redet in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn mit eurem Herzen.“
In Verbindung mit dem Erfülltsein vom Heiligen Geist wird hier das Singen von Liedern erwähnt – aber nicht irgendwelchen Liedern. Es sind Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder.
Psalmen entsprechen den Gesängen aus dem Alten Testament. Loblieder, griechisch Hymnos, sind speziell Lieder zur Anbetung Gottes. Diese können biblische Texte sein oder neu gedichtete Texte, die dem biblischen Inhalt entsprechen.
Geistliche Lieder hingegen sind nicht unbedingt Anbetungslieder, sondern enthalten eine geistliche Botschaft. Nur ein Teil unserer Lieder richtet sich direkt an Gott. Wenn wir zum Beispiel singen „Befiehl du deine Wege“, richtet sich das mehr an unsere Mitchristen als Ermutigung, Sorgen im Vertrauen auf den Herrn abzugeben, der die Welt lenkt.
All diese Lieder haben ihren Platz. Paulus sagt weiter: „Singend und spielend dem Herrn.“ Interessant ist, dass hier nicht nur das Singen, sondern auch das Musizieren mit Instrumenten erwähnt wird. Das griechische Wort „psallo“ bedeutet „zupfen“ und bezieht sich auf das Begleiten des Gesangs mit einem Instrument.
Man könnte sagen, „psallo“ könnte auch einfach „singen“ bedeuten. Doch wenn man das so übersetzt, hieße es „geistlichen Liedern singend und singend dem Herrn“ – das ergibt keinen Sinn. Deshalb kann „psallo“ hier nicht „singen“ bedeuten, sondern „spielen“ im Sinne von Instrumentalbegleitung.
Wer behauptet, im Neuen Testament seien Musikinstrumente nicht angebracht, liegt also falsch. Die Bibel erwähnt hier ausdrücklich Musikinstrumente.
In der Parallelstelle in Kolosser 3, wo es ebenfalls um Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder geht, wird zwar vom Singen gesprochen, das Wort „psallo“ für das Spielen von Instrumenten aber nicht erwähnt. Daraus lässt sich ableiten, dass es kein Gebot ist, beim Singen ein Instrument zu benutzen.
Epheser 5 macht jedoch deutlich, dass Musikinstrumente durchaus Gottes Gedanken entsprechen. Wichtig ist aber immer, dass alles dem Herrn zur Ehre geschieht – soli Deo gloria, allein Gott zur Ehre. Und zwar dem Herrn, der über unser Leben bestimmt und regiert.
Weiter heißt es: „Mit eurem Herzen.“ Das Herz ist das Zentrum des Menschen. In Sprüche 4 heißt es: „Von dem Herzen gehen alle Quellen des Lebens aus.“ Das Herz ist der Sitz unserer Gedanken und Empfindungen.
Im Deutschen unterscheiden wir zwischen Kopf und Herz, doch die Bibel tut das nicht. Die Bibel spricht vom Denken und Fühlen mit dem Herzen – das gehört zusammen und darf nicht getrennt werden.
Wir sollen also dem Herrn mit unserem Herzen singen. Dabei stellt sich die Frage: Wie singe ich christliche Lieder? Einfach nur herunterzusingen, ohne sich mit dem Text zu beschäftigen, sodass der Text nicht mehr ausdrückt, was wir im Herzen empfinden, ist nicht biblisch.
Die Lieder müssen von Herzen gesungen werden – erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist der Ausdruck davon.
Noch etwas Interessantes: Wenn es heißt „spielend“, wie soll man spielen? Das steht im Zusammenhang mit dem Satz „werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr zueinander redet und singend und spielend dem Herrn in euren Herzen.“
Das heißt, auch das Begleiten mit Instrumenten muss aus dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist hervorgehen. Das wird oft übersehen.
Sogar als Instrumentalist ist das nicht eine Nebensache, wie man spielt. Die Verbindung mit dem Herrn muss stimmen. Auch hier gilt: Zum Herrn zur Ehre, mit ganzem Herzen und vollem Einsatz.
Wir können also viel praktisch lernen: Wie soll man singen? Erfüllt vom Heiligen Geist. Wie soll man ein Instrument spielen? Erfüllt vom Heiligen Geist, von Herzen, für den Herrn.
Die Bedeutung der Atemrhythmik in der Musik
Jetzt sehen wir hier Psalm 133 auf Hebräisch. Ich habe bereits erklärt, dass die Rabbiner im Mittelalter diese Kantillationszeichen hinzugefügt haben. So wissen wir, wie diese Musik im Alten Testament geklungen hat.
Zuerst steht nur der Titel, aber schon den singt man: Schir Hamalotl David, ein Lied der Hinaufzüge von David. „Schir Hamalot le David“ ist der Titel. Wir kennen das vielleicht von einem israelischen Lied mit einer anderen Melodie: „Hinneh mat Dorf um manna'im Shevet Achim gam Yachat“. Wenn man jedoch die Zeichen hier verfolgt, sieht man Folgendes:
Es beginnt auf der Quinte, denn wir haben hier diesen Keil, das heißt der fünfte Ton in der Tonleiter. Eine hübsche Melodie, oder? So hat man gesungen. Diese Zeichen geben die Tonhöhe an. Beim ersten Wort „Schir“ sieht man einen Schrägstrich. Das geht wohl zurück auf Handzeichen, die der Dirigent im Tempel jeweils für den Chor und das Orchester gegeben hat. So konnte er genau angeben, welche Töne zu singen sind.
Darum war im Alten Testament im Tempel der Dirigent so wichtig. Wir kennen ihn, nur vielleicht unter einem anderen Namen. In vielen Psalmen steht im Titel „dem Vorsänger“. Ein Psalm von David, „Lamna Zeach“ – der Vorsänger, das war der Dirigent. Der Menazeach war der Dirigent des Orchesters. David hat drei Hauptdirigenten über die vier Musiker seiner Zeit eingesetzt, unter anderem Asaf. So hatte er damals diese Musik eingerichtet.
Mit diesen Zeichen konnte man die Töne angeben. Bei „Schir“ sieht man den Schrägstrich, das ist der zweite Ton in der Tonleiter. Gerade das wäre der Grundton. Dann folgt eine Ecke nach oben und danach eine weitere Ecke – das ist der fünfte Ton. Jetzt kann man also nach diesen Tönen singen. Aber die Frage ist: Welchen Rhythmus nimmt man?
Da stehen keine Tonlängen. Diese ergeben sich durch den Rhythmus der Wörter. Die natürliche Betonung der Wörter bestimmt den Rhythmus, also die Wörter ergeben den Sinn des Rhythmus. Und dann muss man wieder atmen, nicht wahr?
Zum Beispiel: „Siehe, wie gut und wie lieblich“ – da setzt man beim Rezitieren ein bisschen ab. „Wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das Öl auf dem Haupt, das herabkommt auf den Bart Aarons, auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider.“
Das ist eine wörtliche Übersetzung des Textes. Man merkt, man muss nach dem Rhythmus der Wörter gehen. Dort, wo wir im Deutschen ein Komma setzen würden, hält man etwas inne. Man senkt auch die Stimme ein wenig. Die Melodie ist genau so: „Siehe, wie gut und wie lieblich“ – hier sind wir wieder auf dem Grundton. Dann muss man wieder atmen, und dann geht es weiter.
So weiter. Das ist also durch eine natürliche Atmung gegeben, wie man einen Text rezitiert. Das gibt uns wichtige Hinweise, wie Musik sein soll.
Atemrhythmik versus motorischer Rhythmus
Jetzt kommen wir wirklich zur Frage: Was ist Atemrhythmik und was ist motorischer Rhythmus?
Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und gehen an diesem entscheidenden Punkt dann weiter. Danach setzen wir das Thema fort: Was ist Atemrhythmik und was ist motorischer Rhythmus?
Viele kennen wohl das Lied von Graf von Zinzendorf, einen Choraltext: „Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum vor. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun.“
Wir sehen, die Poesie ist so aufgebaut, dass immer eine Verszeile eine Einheit für sich bildet. Zum Beispiel: „Herr, dein Wort, die edle Gabe.“ Dann folgt ein Komma, und da atmen wir, wenn man das rezitiert. „Diesen Schatz erhalte mir,“ da kommt ein Strichpunkt. Dort geht man, wie am Schluss der ersten Zeile, mit der Stimme etwas nach unten, hält inne und atmet.
Dann geht es weiter: „Denn ich ziehe es aller Habe,“ man atmet wieder ein, und „und dem größten Reichtum vor.“ Man geht mit der Stimme nach unten und verlangsamt auch ein bisschen zum Ende, nicht wahr? „Und dem größten Reichtum vor“ – man atmet erneut ein.
„Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen?“ Da geht man ein bisschen mit der Stimme nach oben, weil es eine Frage ist, und atmet wieder. „Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun.“
Also in der Dichtung, überhaupt in der Sprache, haben wir es immer mit Bögen zu tun, nicht mit einzelnen Buchstaben. Einzelne Buchstaben haben keinen Sinn. „Herr“ hat noch keinen Sinn, aber wenn man ein paar Buchstaben zusammensetzt, etwa „Herr“, dann haben wir schon ein Wort. Aber „Herr“ allein sagt noch nicht so viel aus. Ein Satzteil wie „Herr, dein Wort, die edle Gabe“ sagt schon viel aus. Das ist für sich ein sprachlicher Bogen, der dann ergänzt wird durch einen zweiten: „Diesen Schatz erhalte mir“ und so weiter.
Das sind wichtige Überlegungen zur Musik und wie gesungen werden soll – und zwar in der Weiterfolge der alttestamentlichen Musik, die, wie wir gesehen haben, ganz auf das Wort zentriert war und eben den Wortrhythmus auch zum Ausgangspunkt der Rhythmik hatte.
Übrigens, in Epheser 5, wo wir gelesen haben, wer erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und dass man Lieder singen soll, dort steht ja „redend zueinander“. Das ist für uns im Deutschen etwas eigenartig, wenn hier „reden“ steht, wenn es um Lieder geht.
Aber in der Bibel ist es immer so, wenn über Lieder gesprochen wird, dass es dann heißt: „sie sprachen“. Das war zum Beispiel in Offenbarung 5, wenn der himmlische Chor singt, heißt es: „sie sprachen, dann singen sie ein neues Lied.“
Singen ist eben Reden, und dabei wird ein Text, eine Botschaft weitergegeben. Gerade dieses „Reden zueinander“ zeigt, wie die Sprache im Zentrum steht und wie der christliche Gesang logozentrisch ist – so wie der Gesang Israels im Alten Testament.
Praktische Beispiele zur Atemrhythmik in der Musik
Jetzt wenden wir uns diesem Choral zu: Herr, dein Wort, die edle Gabe. Wir haben hier die Noten, und wir sehen, dass der Choral so aufgebaut ist, dass auf jedes Wort oder jede Silbe eine Note kommt. Sehr oft sind das Viertelnoten.
Leider ist es so, dass viele Kinder, die den Musikunterricht besuchen, lernen, wie der Rhythmus funktioniert, zum Beispiel im Viervierteltakt. Man zählt eins, zwei, drei, vier, wobei die erste Note etwas stärker betont wird als die zweite, die dritte wieder etwas mehr, und die vierte ist unbetont. Dann beginnt der Zyklus von neuem: eins, zwei, drei, vier. Oder bei einem Dreivierteltakt zählt man eins, zwei, drei, eins, zwei, drei.
Diese Schüler wollen oft den Lehrern Freude machen, indem sie den Rhythmus ganz genau spielen. Dabei spielen sie jede Viertelnote genau gleich lang. Das wäre eigentlich motorische Rhythmik, nicht wahr? Doch man muss sagen: Das ist völlig unmusikalisch. Die Musik beginnt erst, wenn man die Noten im richtigen Moment spielt.
Ein Schüler würde vielleicht diese Melodie so spielen, und so weiter. Aber das ist nichts. Man muss sich vorstellen, dass jeder Ton nicht einfach für sich steht, sondern wie ein Wort ist. Es muss eine ganze Linie geben, wie einen Satz. Man kann nicht einfach spielen, sondern man muss eine Linie sehen, denn die Noten gehen ja hinauf und dann wieder hinunter.
Beim Text steht zum Beispiel „Gabe,“ mit einem Komma. Dort muss man atmen – auch in der Musik. Das ist eine Phrase, ein Satzteil. Oft ist es so, dass, wenn die Noten hinaufgehen, auch die Lautstärke etwas intensiver wird. Wenn es wieder hinuntergeht, nimmt die Intensität ab, und man verlangsamt ein wenig, also so.
Ich übertreibe, damit man es wirklich merkt. So entspricht das ganz genau den sprachlichen Bögen und den sprachlichen Verszeilen. So muss man auch die Melodieführung gestalten.
Wir können das vielleicht mal singen: zuerst so, wie man es eben nicht singen soll. Jeder Viertelton ist einfach genau gleich. Ja, jetzt habe ich am Schluss ein bisschen verlangsamt, Entschuldigung, es ist so schwierig, falsch zu spielen. Aber sonst haben wir gemerkt, dass wir einfach durchgezogen haben.
Jetzt singen wir es richtig, so dass man die Bögen spürt, dass man atmet und am Ende des Bogens ein wenig verlangsamt. Noch etwas: Wenn eine Note etwas betont ist, bringt man sie oft ein bisschen zu spät. Sie ist dann nicht zu spät, das ist genau richtig. Ich habe hier ein bisschen übertrieben, damit man es merkt.
Das spielt zum Beispiel beim Cembalo eine noch größere Rolle als bei anderen Instrumenten. Auf dem Cembalo sind ja alle Töne grundsätzlich gleich laut. Man kann zwar umstellen, und dann ist man laut oder leise, aber man kann nicht allmählich lauter werden. Deshalb kann man einen solchen Bogen nicht so spielen, wie man das auf der Geige machen würde, wo die Melodie intensiver wird und dann wieder zurückgeht.
Dort macht man alles mit dem „Zu-spät-Kommen“. Es ist also ganz wichtig, dass man zum Beispiel „Herr, dein Wort, die Wort“ ein bisschen später spielt. Durch das Zu-spät-Kommen bekommt die Note einen Akzent, ohne dass man mehr Druck ausübt.
Jetzt mal richtig, damit man spürt, wie es anders ist:
Größten Reichtum für,
wenn dein Wort nicht mehr soll gelten,
worauf soll der Glauber ruhen?
Mir ist nicht um tausend Welten,
aber um dein Wort zu tun.
Merkt man den Unterschied? Ich hoffe es.
Ich habe in Vorträgen festgestellt, dass viele nicht herauskommen, wenn ich das erkläre. Auch musikalische Menschen nicht. Dann hört man oft, dass Popmusik genauso sei wie klassische Musik. Da habe ich gemerkt, dass ich es noch besser erklären muss.
Darum habe ich diesen Vortrag gemacht, mit Beispielen und gemeinsamem Singen, damit man es wirklich merkt. Auch mit der Rezitation von Gedichten, damit man begreift, wie diese Bögen funktionieren.
Ich habe das schon an einem anderen Ort gemacht, und da sagte jemand, der sehr musikalisch ist: „Aber beim Winter von Vivaldi ist es doch motorisch.“ Nein, auch dort ist es nicht motorisch. Natürlich gibt es schnelle Passagen, die genau im Takt gespielt werden. Aber das sind Bögen, und man muss hören: Sobald der Bogen abgeschlossen ist, wird es langsamer. Man atmet, aber sehr kurz, weil das Ganze sehr schnell ist.
Zum Beispiel im ersten Satz, wo das Sommergewitter gespielt wird, ein Sommersturm. Es ist atemrhythmisch, und deshalb geraten die Leute nicht aus dem Takt.
Ich habe vom Sommer gesprochen, aber es ist ähnlich beim Winter, dort gibt es einen Wintersturm. Bei beiden, Sommer und Winter, gibt es einen sehr schnellen, heftigen Sturm, aber es ist atemrhythmisch. Die Bögen werden immer eingehalten.
Man kann das nicht einfach mit einem Schlagzeug durchschlagen, dann gerät man völlig daneben. Es funktioniert nicht.
Stimmen aus der Musikpädagogik und Komponisten zur Rhythmik
Elmar Bozzetti schreibt in seinem Buch „Einführung in musikalisches Verstehen und Gestalten“ (Frankfurt 1988):
„Die allgegenwärtige Unterhaltungsmusik heute rückt Grundschlag und gleichförmige Taktbetonung stark in den Vordergrund, damit der Konsument sich einschwingen kann in eine gleichförmige Bewegung, von der er sich passiv und selbstvergessen tragen lassen kann. Das Metrum, also der Grundschlag, bekommt so die Bedeutung eines kollektiven Gleichschritts, der jede Regung des individuellen Bewusstseins verdrängt und jede innere Aktivität lähmt. Und das ist noch wichtig: Der kollektive Gleichschritt – das ist ja auch bei der Militärmusik, wenn sie ganz motorisch gespielt wird – war eben die Absicht. Die Soldaten sollten sich als eine Einheit fühlen. Heute, neurologisch betrachtet, kann man sagen, da wird der Parietallappen etwas heruntergefahren. Dann fühlt man sich mit der Umwelt eins. So fühlen sich die Soldaten, die miteinander im Gleichschritt laufen, völlig motorisch verbunden. Sie fühlen sich miteinander verbunden, denn wir gehören zusammen, wir haben einen gemeinsamen Feind.
Und das Gleiche gilt auch in der Technomusik. In der Technomusik gibt es nicht viele Aggressionen und Schlägereien bei großen Umzügen wie Loveparade und Streetparade. Dort wird immer wieder gelobt, wie friedlich diese Veranstaltungen sind. Bei der Technomusik, wo die Grundschläge extrem schnell sind, fährt offensichtlich genau der Parietallappen besonders herunter. Dann fühlt man den Unterschied im Raum nicht mehr, man fühlt sich mit den Leuten nebenan eins. Darum wird auch oft gesagt, dass in der Technomusik Feindschaften aufhören und dass Leute, die einem lästig oder unangenehm sind, plötzlich nicht mehr so empfunden werden. Aber das ist eine Täuschung, weil das Gehirn eben so heruntergefahren wird.
Im Hardrock ist der Grundschlag ebenfalls ganz genau gleich, aber nicht so schnell wie beim Techno. Dort bewirkt er etwas anderes im Gehirn, das heruntergefahren wird, und dort löst es Aggression aus. Das ist die Erklärung, warum bei Hardrockkonzerten so oft Schlägereien vorkommen können, hingegen bei Techno nicht. Das hängt damit zusammen, dass andere Hirnteile heruntergefahren werden.“
Ein weiteres Zitat von Hugo Riemann, einem großen Musikpädagogen und Begründer eines der wichtigsten Musiklexika, das einfach „der Riemann“ genannt wird – eine umfassende Wissenssammlung für Musiker und Musikwissenschaftler:
Hugo Riemann schrieb zum genauen Spielen im Takt:
„Zum Beispiel nach dem Metronom, das ist diese Maschine da nebenan, ist ohne lebendigen Ausdruck maschinenmäßig unmusikalisch.“
Das ist ein hartes Urteil: Es ist nicht Musik, sondern unmusikalisch. Darum, wenn Schüler mit dem Metronom üben, dann geht es nur darum, dass sie wissen, was eigentlich das Grundtempo ist, von dem ausgegangen werden muss. Aber jetzt muss man nicht so spielen, sonst macht man keine Musik. Dieses Grundtempo muss man bis zum Schluss halten, das muss man lernen. Innerhalb des Stücks wird der Rhythmus geführt, die Viertelgrundschläge werden verlangsamt und im richtigen Moment wieder angezogen.
Ludwig van Beethoven, einer der größten Komponisten der Weltgeschichte, schrieb:
„Meine Musik soll mit dem Gemüt und nicht mit dem Metronom aufgefasst werden. Man muss sie fühlen und begreifen wie eine gelungene Dichtung und nicht sie mit bloßer Fingerfertigkeit spielen.“
Das ist bedeutsam. Er sagt klassisch, man darf nicht metronomisch spielen. Er macht den Vergleich mit einer Dichtung. Ein Beispiel ist Beethovens Sonate F-Moll im Viervierteltakt. Sie beginnt mit einem Auftakt, und so weiter. Man merkt, wie sie gespielt werden soll – eben nicht metronomisch, also nicht einfach eins, zwei, drei, vier. So würde ein Schüler spielen, der den Rhythmus noch nicht richtig verstanden hat.
Ein weiteres Zitat von Franz Liszt, einem der größten Pianisten, der das berühmte S-Tour-Klavierkonzert komponierte – das ist das Orchester, und dann kommt das Klavier. Er konnte schon Klavier spielen. Liszt schreibt:
„Allerdings ist der metronomische Vortrag lästig und widersinnig. Zeitmaß und Rhythmus müssen sich der Melodie, der Harmonie, dem Akzent und der Poesie fügen.“
Das ist ganz klar keine private Idee. Auch hier wird wieder Poesie als Vergleich herangezogen. Man geht von der Sprache aus, von der natürlichen Sprache.
Es ist eben so: Diese Atemrhythmik entspricht den natürlichen Zeitrhythmen des menschlichen Organismus. Der Puls ist ja auch nicht immer gleich. Wenn wir in eine angespannte Situation kommen, dann steigt der Puls, und wenn wir uns wieder beruhigen, geht er wieder runter. Er verläuft auch in großen, langen Bögen – Puls und Herzfrequenz. Bei der Atmung ist es genauso: Wir atmen nicht immer gleich. Wenn wir in Anstrengung oder Stress geraten, steigt die Atmung, ohne dass wir es bewusst merken. Wenn sich der Körper beruhigt, geht sie wieder runter.
Man hat das auch bei Leuten gemessen, die Musik hören. Wenn sie zum Beispiel das Brandenburgische Konzert von Bach hören, sieht man, dass die Atmung schneller wird, sobald die Musik intensiv und schnell wird – allerdings leicht zeitversetzt. Es ist schön, diesen Ausdruck, einen Computerausdruck mit den Noten, zu sehen. Die Herzfrequenz steigt, aber etwas später, nachdem die Musik intensiver geworden ist. Wenn die Musik sich wieder beruhigt, sinkt die Atmung ebenfalls zeitversetzt wieder ab.
Auch die Gehirnstromfrequenzen verlaufen in Bögen, sie sind nicht immer gleich. Wir haben solche Zeitrhythmen im menschlichen Organismus. Es gibt solche, die über ganz lange, große Bögen verlaufen, und solche, die über kürzere Bögen verlaufen. So ist die Musik ebenfalls aufgebaut: aus kleineren Bögen, die sich zu größeren Bögen zusammenfügen. Das muss man alles bei der Interpretation beachten.
Die Taktmotorik der Rock- und Popmusik, der afroamerikanischen Musik und der charismatischen Lieder ist dagegen nicht natürlich, entspricht gar nicht dem, wie wir gebaut sind, und ist destruktiv. Diese Rhythmik stammt aus den ekstatischen Kulten Afrikas. Und das ist neu in unsere Zeit in die Gemeinden hineingekommen.
Entwicklung der Mehrstimmigkeit und musikalische Harmonie
Das ist übrigens die Sonate, die ich da ein bisschen im Dunkeln gespielt habe. Man sieht, es ist Viervierteltakt. Dabei merkt man, dass ich den ersten Schlag manchmal ein wenig zu spät gesetzt habe, oder? Eins, zwei, drei, vier – ein bisschen übertrieben!
Durch dieses verspätete Setzen entsteht ein Akzent. Jetzt spiele ich das Ganze noch einmal im Zusammenhang, ohne dazwischen zu sprechen. Und jetzt folgt eine große Verzögerung. Das hat der Komponist sogar noch notiert. Normalerweise schreibt er das nicht hin. Man muss einfach wissen, wo man verlangsamen muss. Aber wenn die Verzögerung zu stark ist, ist es natürlich nötig, sie zu markieren.
Jetzt atme ich ein – ich hätte also etwas kürzer sein sollen. Und jetzt? Ja, da war eine falsche Note. Gut, an diesem Beispiel hat man es, denke ich, gut gesehen: Nach der verlangsamten Stelle geht es wieder a tempo weiter. Man atmet ein und kehrt zum Grundtempo zurück.
Ein besonders gutes Beispiel, wo man das gut versteht, ist Nummer vier aus den 24 Präludien von Frédéric Chopin. Das habe ich vor kurzem in Bolivien gespielt – für deutschstämmige Mennoniten und Kichwa-Indianer aus dem Bergland. Nach dem Vortrag kam ein junger Mann zu mir und sagte, dass er das richtig gespürt habe.
Das Stück ist sehr langsam, ausdrucksvoll und einfach. Es ist nicht prätentiös, sondern hat eine ganz einfache Melodie in einem kleinen Tonraum, begleitet von Achtelnoten. Jetzt spiele ich das mal vor, und man merkt, wie stark die Länge der Achtelnoten variiert. Aber nicht plötzlich, denn das wäre unmusikalisch. Wenn jemand einen Choral so spielen würde, wäre das unrhythmisch. Man kann die Notenlängen nicht willkürlich verändern, sondern die Veränderungen müssen im Verlauf der Bögen geschehen – und hier genauso.
Gut, wir haben uns gemerkt, dass das sehr ausdrucksvoll ist. Jetzt könnte ich das Stück metronomisch spielen. Dann merkt man, dass die ganze seelische Tiefe zerstört wird. Man kann die tiefen Gefühle des Menschen nicht mit motorischer Rhythmik ausdrücken. Es entsteht nur eine oberflächliche, ausgelassene, feuchtfröhliche Stimmung. Den Unterschied merkt man sofort. Die Emotionen gehen verloren.
Diese Emotionen entstehen durch das leichte Verspäten der Noten. Das macht den Unterschied aus, oder? Ganz leicht verspätet. Natürlich habe ich es jetzt auch ein bisschen langsamer gespielt als im vorherigen Beispiel. Aber dadurch wird deutlich: Beim langsamen Spielen geht es wirklich um das Führen des Tempos. Beim schnelleren Grundtempo klingt es einfach flott.
Ich fasse zusammen: Die variable Atemrhythmik ermöglicht den Ausdruck tief liegender seelisch-geistiger Regungen. Durch die Taktmotorik wird dieser Ausdruck zerstört. Wir sehen auch, dass gerade in diesem Bereich ein wesentlicher Teil der künstlerischen Arbeit in der Musik liegt.
Wenn man Musik nur metronomisch spielen würde, würde ich wahrscheinlich aufhören, Klavier und Geige zu spielen. Das wäre einfach zu langweilig!
Stellungnahmen zu moderner christlicher Musik
Mit dem Choral als Ausgangspunkt und einigen klassischen Musikbeispielen möchte ich nun einige Zitate von Christen vorstellen, die sich für moderne Musik in der Gemeinde ausgesprochen haben. Diese Personen haben in den vergangenen Jahren erheblichen Einfluss ausgeübt.
Steve Lohett, Mitglied der Rockband Mother Rush, schreibt in seinem Buch Christliche Rockmusik – Ein Schaf im Wolfspelz. Leider hat Manfred Siebald, der viele schöne Lieder komponiert hat – einige atemrhythmisch, andere eher motorisch –, ein Vorwort dazu verfasst. Steve Lohett schreibt: „Musik in jeglicher Form ist von Gott gegeben. Etwas von Gott Geschaffenes teuflisch zu nennen, erweitert Satans ohnehin begrenzten Machtbereich und verringert Gottes höchste Gewalt. Das ist Gotteslästerung.“
Diese Aussage ist sehr stark, und sie ist falsch. Das lässt sich mit einem anderen Beispiel zeigen. Musik hat göttlichen Ursprung, denn in Hesekiel 28 lesen wir, dass als dieser Engel, der später zum Satan wurde, erschaffen wurde, auch seine Musikinstrumente von Gott bereitet wurden – Flöte und Tamburin. Es war ein Musikerengel im himmlischen Tempel (Hesekiel 28, der genaue Text steht in der alten Elberfelder Übersetzung).
Musik ist also von göttlichem Ursprung, sagt die Bibel. Musik gab es, bevor es irgendeine Sünde gab. Aber auch Sprache ist Gottes Werk. Wer hat die Sprache Adam gegeben? Gott. Am Tag seiner Erschaffung konnte Adam sprechen und sogar dichten. Bei Babel hat Gott verschiedene Sprachen für die verschiedenen Völker erschaffen.
Sprache ist Gottes Werk. Nun setzen wir anstatt Musik das Wort Sprache ein: Sprache in jeglicher Form ist von Gott gegeben. Etwas von Gott Geschaffenes teuflisch zu nennen, erweitert Satans ohnehin begrenzten Machtbereich und verringert Gottes höchste Gewalt. Das ist Gotteslästerung. Doch Sprache in jeglicher Form bedeutet auch all die Bücher mit üblem Inhalt, die es gibt und die manche, gerade Kantonsschüler, lesen müssen.
Bei vielen Büchern muss man sagen: Das ist teuflisch, das ist wirklich verdrehtes Denken, das da in Sprache ausgedrückt wird. Und da kann man doch nicht sagen, Sprache in jeglicher Form sei von Gott gegeben. Aber was wir mit der Sprache und ihren Möglichkeiten tun, das ist unsere Verantwortung. Wir können die Sprache zum Guten einsetzen, wir können sie aber auch zum Schlechten gebrauchen.
Wir können auch ein Gedicht in eine Form bringen, die völlig unnatürlich ist. Das sehen wir beim Rap. Dort wird die dichterische Form in ein Korsett gedrückt. Ich wollte eigentlich noch ein Gedicht von Mörike vortragen, doch mir fehlt der Text. Hätte ich es mit Schlagzeug begleitet und vorgetragen, würde man merken, dass beim Rap die Sprache nicht mehr natürlich ist. Sie wird in ein rhythmisches Stahlgitter gepresst, und das ist Missbrauch der Sprache. So ist Sprache nicht gemeint.
Hans-Arved Willberg schreibt in seinem Buch Streit um Töne – Die Christen und die Rockmusik (Brunnenverlag 1991): „Alles ist euer, ist uns gesagt. Also auch Verstärkeranlagen, elektrische Gitarren, Schlagzeug, grundsätzlich auch jeder Rhythmus, jeder Stil. Wenn die Musik eine herrliche Gabe Gottes ist, dann ist sie es als Ganzes, in der ganzen Fülle ihrer formalen Möglichkeiten. In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Deshalb ist der Glaubende nicht nur zu einem ganzen Ja zu Gottes Schöpfung aufgerufen, sondern eigentlich sogar dazu verpflichtet.“
Verweigert er sich diesem Ja, fällt er zurück in Gesetzlichkeit (vgl. Galater 5,1) und verliert dadurch an missionarischer Stoßkraft, weil er seine gottgeschenkte Kreatürlichkeit und Kreativität mit Fleischlichkeit verwechselt und bekämpft. Er entwickelt eine Tendenz zum religiösen Neurotiker. Das ist nur eine Tendenz, ich habe es noch nicht ganz, aber die Tendenz ist da – zum profillosen Mitläufer und starren Verfechter vermeintlicher geistlicher Erkenntnisse.
Hier zeigt sich wieder derselbe Denkfehler: Musik kommt zwar von Gott, aber die Musikstücke komponieren wir Menschen. Wir können sie so komponieren, dass sie dem Menschen entspricht, oder so, dass sie zum Beispiel Trance auslöst – und das ist gegen Gottes Wort.
Martin Bühlmann von der Vineyard Bern hat gesagt: „Der Rock and Roll hat der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln.“ Wenn man bedenkt, dass das Wort Rock and Roll „Hurerei“ bedeutet und in Epheser 5 gesagt wird, wir sollen dieses Wort nicht einfach so verwenden („Hurerei werde nicht einmal unter euch genannt, gleich wie es Heiligen geziemt“), dann ist das schon krass.
Natürlich hat diese Musik nicht nur den Westen erobert, sondern die ganze Welt. Die gleiche Musik hört man in Thailand, in Afrika – in Togo, Ghana, Benin – und auch in Südamerika, überall.
Peter Strauch, einst Vorsitzender der Evangelischen Allianz, hat sich in Ideaspectrum Nr. 18, Mai 1994, folgendermaßen geäußert: Christen können alle Stilarten von Musik hören und auch selbst machen. Zweitens sagte er, die christliche Rockmusik gebe es nicht. Auch heute gängige Musikstilarten wie Klassik und Rock hätten ihre Wurzeln im Heidentum. Das stimmt nicht. Die Klassik hat nicht ihre Wurzeln im Heidentum, sondern geht musikgeschichtlich zurück auf die frühchristliche Musik, die aus Israel kam. Die Wurzeln liegen im Alten Testament. Das ist also geschichtlich falsch.
Der Rock hingegen hat, was die Rhythmik betrifft, Wurzeln im Heidentum. Weiter sagt er: Christliche Musik sei einfach Musik, die Christen ausführen. Entscheidend sei, man müsse sich fragen: Wer soll mit Musik erreicht werden? Was soll bewirkt werden? Auf diese Weise komme man zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Musik.
Noch wichtiger ist, was Rick Warren in The Purpose Driven Church (Kirche mit Vision) schreibt. Dort gibt es ein ausführliches Kapitel über Musik. Obwohl der Untertitel lautet Growth without compromising your message and mission – also Gemeindewachstum ohne Kompromiss bezüglich Botschaft und Mission – schreibt er, die Wahl der Musik in der Gemeinde sei eine der wichtigsten Entscheidungen im Blick auf Gemeindebau.
Er sagt weiter: Man kann keine Musikstile als gut oder schlecht bezeichnen. Aber wir haben gesehen, man kann die motorische Rhythmik als Stilmittel wirklich als schlecht bezeichnen, ja, man muss es sogar.
Wieder sagt er, es gebe keine christliche Musik, Musik sei gewissermaßen neutral. Er rät, die Musik gemäß dem Geschmack der Leute zu wählen, die man erreichen will. Nach der Entscheidung bei ihnen in Saddleback für Rock- und Popmusik – so nennt er die christliche Anbetungsmusik, die charismatischen Lobpreislieder bezeichnet er als Rock- und Popmusik – sei das Gemeindewachstum explodiert.
Darum sagt er, das sei ganz entscheidend. Dort finde man den Schlüssel, ob Gemeinden wachsen oder nicht. Aber der Schlüssel liege eben in der motorischen Rhythmik. Schon interessant, nicht wahr?
Entwicklung der Mehrstimmigkeit und musikalische Notation
Jetzt möchte ich noch weiter ausführen. Wir haben gesehen, wie die Musik Israels nach Europa kam und die heidnische Musik verdrängte. Diese Musik bestand aus einstimmigen Liedern, wie zum Beispiel „Hinne wat ho funam anim sheved achim gam jachat“. Auch die frühchristlichen Lieder waren einstimmig, so wie es damals weltweit üblich war. Mehrstimmigkeit gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Vom ersten bis zum neunten Jahrhundert wurden die Lieder deshalb mündlich überliefert. Das war möglich, weil alle die Lieder auswendig lernen konnten. Außerdem musste die Überlieferung mündlich erfolgen, da es keine gebräuchliche Notenschrift gab.
Ab dem neunten Jahrhundert wurde in der Kirche eine Notation eingeführt. Man sieht hier die sogenannten Neumen. Diese ähneln stark den Zeichen, die wir in der hebräischen Bibel finden. Sie geben ungefähr die Tonhöhen an, allerdings nicht sehr genau. Man konnte die Lieder also nur singen, wenn man sie bereits einmal gehört und gekannt hatte. Die Neumen halfen dann, die Tonhöhen anzudeuten.
Im elften Jahrhundert kam die Notenschrift mit Notenlinien auf, entwickelt von Guido von Arezzo. Nun konnten die Tonhöhen eindeutig notiert werden. Ab dem dreizehnten Jahrhundert wurden neben den Tonhöhen auch die Tondauern angegeben, was die Notation noch genauer machte. Seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts gibt es die moderne Notenschrift, wie wir sie heute kennen. Diese entwickelte sich besonders für die Musik des Barock.
Nun möchte ich kurz erklären, wie die Mehrstimmigkeit entstanden ist. Ursprünglich gab es nur einstimmige Lieder. Ab dem neunten Jahrhundert kam die Idee auf, das Lob Gottes durch Mehrstimmigkeit zu erhöhen. Zum Beispiel durch einen Bordun, einen Liegeton: Eine Stimme singt „Halleluja!“, das klingt zunächst etwas eintönig. Dann singen andere Stimmen darüber ebenfalls „Halleluja, Halleluja“. Der Ton klingt weiter und mit einer Orgel klingt es noch voller.
Das ist eine einfache Form der Mehrstimmigkeit. Später kam man auf die Idee, im Abstand von vier oder fünf Tönen zu singen. Ein Beispiel dafür ist das Organum „Rex Coeli Domine, Maris und Soni“ – „König des Himmels, o Herr!“ Die beiden Stimmen beginnen zusammen, entfernen sich bis auf einen Abstand von vier Tönen und bleiben dann in diesem Abstand, bevor sie wieder zusammenkommen. So entstand eine einfache Zweistimmigkeit.
Später entwickelte man auch Dreistimmigkeit und schließlich Vierstimmigkeit. Die Motivation dahinter war, das Lob Gottes so großartig wie möglich zu gestalten. Diese Entwicklung zum vierstimmigen Choral ist einzigartig in der Weltgeschichte. Sie entstand nur in Europa und im Rahmen des Christentums.
Johann Sebastian Bach führte die Mehrstimmigkeit zum Höhepunkt. Der Bachchoral wurde zum Vorbild für das Chorälschreiben. Anhand der Bachchoräle kann man Komponieren lernen. Wer das beherrscht und versteht, kann Sonaten, Sinfonien und andere Werke komponieren.
Wie kam man auf die Idee der Mehrstimmigkeit, die schließlich auf Dreiklang und Vierklang basiert? Diese Idee ist in der Natur vorgegeben. Wenn man beispielsweise eine Posaune nimmt und den tiefsten Ton bläst, erhält man vielleicht ein C. Bläst man etwas stärker, erklingt eine Oktave höher. Noch etwas mehr Luftdruck erzeugt einen Ton fünf Töne höher, noch mehr einen vierten Ton.
Das Interessante daran ist, dass sich so der Dur-Dreiklang ergibt. Bläst man weiter, entsteht der Vierklang, der Dominantseptakkord. So sind diese Töne physikalisch in der Natur vorgegeben.
Man kann das auch mit Saiten erklären: Wenn man eine Saite in der Mitte teilt, erklingt eine Oktave höher. Teilt man sie weiter, entstehen weitere Töne aus dieser Reihe. Der Dur-Dreiklang ist also vorgegeben.
Wenn man den Dur-Dreiklang an einer Spiegelachse spiegelt, erhält man den Molldreiklang. Er ist einfach die Spiegelung des Dur-Dreiklangs. Diese Grundlagen bilden die Basis für den vierstimmigen Choral.
Im vierstimmigen Choral steht das Wort stark im Mittelpunkt. Jede einsilbige Silbe hat einen Ton. Die Harmonien wechseln schnell. Mit jedem Wort und jeder Silbe kommt ein anderer Akkord in einer neuen Stellung hinzu. So entsteht eine lebendige und ausdrucksstarke Musik.
Musik im Barock und die Verbindung zur Schöpfung
Jetzt müssen wir in ein paar Minuten noch den Rest durchgehen. Die Barockmusik, also die Musik aus der Zeit, als die moderne Notenschrift entstand – etwa von 1600 bis 1750 –, fiel in eine Epoche großer Entdeckungen des Weltalls. Kepler und Newton entdeckten Gesetzmäßigkeiten, mit denen man den Lauf der Planeten mathematisch berechnen kann.
Ganz Europa stand unter dem Eindruck dieser Harmonie am Himmel. Die Planeten stoßen nicht zusammen, sondern alles ist mathematisch genau vorgegeben und nachvollziehbar. Deshalb war Europa so beeindruckt. Auch die Reformatoren sagten damals, dass die Bibel zur wissenschaftlichen Erforschung der Natur ermutigt, um dadurch die Größe Gottes zu erkennen.
Die Musik wurde so komponiert, dass sie zur Ehre des Schöpfergottes sein sollte. Die Ordnung und Harmonie in der Schöpfung sollten in der Musik widergespiegelt werden. Deshalb komponierte Bach zum Beispiel Fugen – hier nur ein kleines Beispiel einer fünfstimmigen Fuge. Aber nicht die ganze, denn wir haben keine Zeit mehr.
Eine Fuge ist eine Art Kanon. Das ist das Thema. Dieses Thema wird zuerst in einer Stimme vorgestellt, dann in einer zweiten, einer dritten, einer vierten und schließlich in einer fünften Stimme. Das ist der erste Teil der Fuge; sie geht noch weiter.
Jetzt hören wir einfach mal, wie das klingt. Die Fuge soll nachbilden, wie die Planeten alle in Ordnung und ohne Zusammenstoß nach mathematischen Gesetzen laufen. Dann kommt die fünfte Stimme usw. Später macht Bach kunstvolle Variationen, und am Schluss das größte Kunststück: Er bringt das Thema noch einmal in jeder Stimme, aber jeweils um einen Ton verschoben. Alle Stimmen erklingen gleichzeitig, doch immer um einen Ton versetzt – es entsteht kein Chaos.
Ich spiele ein bisschen vor und sage dann „jetzt!“ Dann beginnt die erste Stimme, und so geht es los. Einfach, damit man es mal gehört hat. Ich setze kurz vorher ein: „Jetzt!“ Ja, da, wo es nicht ganz stimmte, war das mein Fehler, weil ich im Dunkeln nicht gut lesen kann. Aber man sieht: In Harmonie geht es weiter.
Diese Musik war Musik zur Ehre des Schöpfergottes. Man muss sagen, das galt allgemein unter den Komponisten dieser Zeit, auch bei Händel, Vivaldi, Marcello und anderen. Sie alle waren von diesen Gedanken geprägt: Musik ist zur Ehre des Schöpfers.
Wandel in der Musikgeschichte und seine Bedeutung
Aber dann kam die Zeit der Klassik, und im europäischen Denken rückt der Mensch mehr und mehr ins Zentrum. Deshalb ändern sich auch die Melodien. Die Söhne von Bach sagten sich: Wir möchten nicht immer nur so gewichtige Melodien schreiben wie unser Vater. Wir möchten auch Melodien schreiben, die man zum Beispiel unter der Dusche singen würde.
Darum hat Mozart so komponiert. Er kann aber auch ernster werden. Dann kommt das zweite Thema und so weiter. Man findet eher eingängige, graziöse und liebliche Melodien, um Freude, Traurigkeit, Melancholie oder Jubel auszudrücken. Das ist auch gottgemäß, denn Gott hat uns ja die Lieder in der Gemeinde gegeben, um auszudrücken, was wir für den Herrn empfinden.
Sonst könnte man ja auch die Gedichte einfach zusammen rezitieren, so wie das beim Vaterunser geschieht. Es ist möglich, dass alle gemeinsam das Vaterunser aufsagen. Aber damit kann man nicht das Gleiche ausdrücken wie mit einem Choral. Es ist einfach anders, und Gott möchte, dass wir das ausdrücken. Darum muss man sagen, dass auch die klassische Epoche immer noch ganz der Schöpfungsordnung Gottes entspricht und aus dieser christlichen Tradition herauskommt.
Dann kommt die Romantik im 19. Jahrhundert, und dort wird die Musik Ausdruck persönlicher und völlig subjektiver Empfindungen und Gefühle. Mozart hat zum Beispiel Freude in einem Stück ausgedrückt, in einem anderen Traurigkeit. Das musste aber nicht seine persönliche Empfindung sein.
Ein Beispiel ist die E-Moll-Sonate für Violine und Klavier. Diese hat er komponiert, nachdem er erfahren hatte, dass seine Mutter gestorben war. Das war schlimm für ihn, und er konnte nicht zum Begräbnis gehen, weil er zu weit entfernt war. Wenn man die Sonate hört, klingt sie melancholisch, aber sie drückt nicht unbedingt seine genauen Gefühle aus.
In der Romantik wird die Musik Ausdruck ganz persönlicher und subjektiver Empfindungen und Gefühle. Man sucht die Grenzen. Die Klavierkonzerte werden immer schwerer und virtuoser. So etwas hätte man sich früher bei Mozart oder den Bachsöhnen nie vorstellen können, mit Läufen, Oktaven und Ähnlichem.
Die Orchester werden immer größer, und man geht mit den Tonarten bis an die Grenze. Ist das noch in der Tonart? Wenn man die Noten genau ansieht: Ja, natürlich ist es immer noch in der Tonart. Aber man hört das nicht mehr so deutlich, durch die Chromatik wird das manchmal etwas verschleiert. Es ist aber immer noch genau tonal.
Dann kommt das 20. und 21. Jahrhundert. In der sogenannten klassischen oder ernsten Musik kommt das Durchbrechen der Tonalität. Das geschieht genau in der Zeit, in der sich immer mehr Intellektuelle von Gott und der Bibel entfernen – zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die breite Masse folgte diesem Abfall von Gott erst später.
Das drückt sich darin aus: Wir wollen nicht mehr diesen Dreiklang, das ist langweilig. Man weiß immer genau, was am Ende kommt. Außer zwischendrin mal, wenn man sich fragt: Was kommt jetzt? Ja, das war aber ein Trugschluss, ein tiefgreifender, alterierter Trugschluss auf der sechsten Stufe. Aber eben nichts mehr mit dem Dreiklang, sondern so wie die RS zwei am Abend.
Das war ein Bruch mit der Vergangenheit. Gleichzeitig fiel dieser Bruch mit dem Christentum und der Bibel zusammen. In der Unterhaltungsmusik zur gleichen Zeit bleibt man beim Dreiklang, natürlich. Aber in der Unterhaltungsmusik ersetzt die motorische Rhythmik den Atemrhythmus. Damit wird die Schöpfungsordnung durchbrochen.
Dieser Bruch hängt direkt zusammen mit einem Bruch, der in Europa und Amerika nach 2000 Jahren Christentum gekommen ist. Darum müssen wir sehen, dass hier eine Trennlinie besteht. Das können wir nicht in die Gemeinde hineinnehmen, genauso wenig wie die Atonalität.
Wer wollte einen Bibeltext singen, der atonal vertont ist? Es gibt Komponisten, die haben Psalmen so vertont. Dann merkt man: Es ist ein Bruch, das geht gar nicht. Darum geht auch die motorische Rhythmik nicht. Sie ist ein Bruch mit der Schöpfungsordnung und mit den Geboten Gottes.
Schlussfolgerung und Gebet
So können wir die Frage ganz klar bejahen: Ist Musik wirklich neutral? Nein, das ist sie nicht. Wir haben tatsächlich Kriterien, um das zu beurteilen.
Ich hoffe, dass dies hilft, den Unterschied selbst zu erkennen, wenn man ein Lied oder ein Musikstück hört. Man kann zum Beispiel motorisch mitklopfen und beobachten, ob jeder Schlag genau gleich ist. Oder man merkt, dass es eher atemrhythmisch ist und nicht nachgegeben wird. Diese Art von Musik soll das Rauschhafte fördern.
Deshalb spielt der charismatische Lobpreisgesang eine ganz wichtige Rolle in der charismatischen Bewegung. Er ist verbunden mit ekstatischen Erfahrungen wie Umfallen und Zungenreden. Dabei kann man sogar am Gehirn messen, wie bestimmte Hirnareale heruntergefahren werden. Andrew Newberg hat das mit einem Spekt-Gerät nachgewiesen.
Diese Musik ist also ganz grundlegend. Ohne sie könnte die charismatische Bewegung gar nicht richtig leben. Wenn man diese Musik wegnimmt, merkt man erst, was dann noch bleibt.
Zum Schluss möchte ich mit Philipp 4,8 schließen, wo der Apostel Paulus sagt: Ganz allgemein, für alle Lebensbereiche, aber eben auch für die Musik, soll man alles erwägen, was würdig, gerecht, rein, lieblich und wohllautend ist. Wenn es irgendeine Tugend und irgendein Lob gibt, dann soll man das bedenken.
Zum Abschluss wollen wir noch gemeinsam beten:
Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute in Ruhe und Frieden zusammen sein dürfen, um über dein Wort nachzudenken – besonders über dieses wichtige Thema der Musik, das in den vergangenen Jahrzehnten so viel in den Gemeinden verändert hat. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, wirklich deinen Weg zu gehen. Und dass wir gerade in dieser Endzeit deine Hilfe und dein Durchtragen erfahren dürfen. Amen.