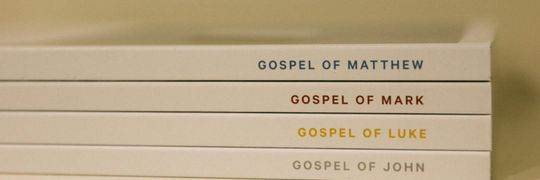
Einstieg in das Bibelstudium: Lesen als Grundlage
Heute lösen wir uns ein wenig von der historischen Ebene und wenden uns dem Matthäusevangelium zu. Ich hatte vor, euch heute eine Art Gedankeneintopf zu präsentieren. Gedankeneintopf deshalb, weil ich eine Reihe von Themen zumindest streifen werde. Manche dieser Themen werden wir vielleicht an anderer Stelle oder im persönlichen Gespräch noch weiterführen. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe noch Fragen oder möchte etwas genauer wissen, wunderbar, das machen wir dann.
Alle diese Themen sind irgendwo wichtig. Die erste Frage, die mich heute Abend interessiert und hoffentlich auch euch, lautet: Ich habe hier eine Bibel, und das ist ja nun ein ziemlich dickes Buch. Wie studiere ich so eine Bibel eigentlich? Viele Leute sind sich darüber im Klaren und sagen: Du musst die Bibel studieren. Ja, jeder Christ wird sagen, klar, das musst du machen. Aber auf der ganz praktischen Ebene: Wie funktioniert das eigentlich?
Wenn man Bibelstudium auf die unterste Ebene herunterbricht, ist es etwas ganz Banales. Die unterste Ebene des Bibelstudiums heißt Lesen. Das bedeutet, es gibt kein Bibelstudium, ohne dass man die Bibel nicht durchliest.
Eine Sache, die ihr in der Lektion 4a hättet erleben müssen – vielleicht zum ersten Mal, ich hoffe nicht zum ersten Mal – war, dass man ein Buch der Bibel durchliest und zwar mit einer bestimmten Frage im Kopf. Die Frage, die ihr im Kopf haben solltet, war: Wo finde ich Prophetien und wo finde ich Aussagen zum Gebet? Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache.
Ich lese Matthäus durch und mache nichts anderes, als erst einmal nur zu lesen. Dabei frage ich mich: Was steht hier über Gebet und was steht über Prophetie? Dann habe ich meine zwei Tabellen. Ich muss mir gar nicht viel überlegen, ich arbeite das einfach durch.
Oder wir hatten das letzte Mal diese kleinen Neuen Testamente verteilt. Vielleicht hat manch einer von euch einfach nur darin gelesen und immer, wenn er etwas gefunden hat, an die Seite ein „G“ für Prophetie geschrieben oder etwas unterkringelt. Aha, da muss ich mir am Abend dann etwas überlegen.
Wenn ihr das ganz klar sehen wollt, dann ist das eigentlich Bibelstudium: Ihr lest die Bibel mit einer bestimmten Fragestellung und zieht aus der Bibel die Antwort auf diese Frage heraus. Und nichts anderes ist Bibelstudium.
Das heißt, jeder von euch hat, auch wenn ihm das vielleicht gar nicht so bewusst war, in den letzten beiden Wochen über Matthäus ein Bibelstudium gemacht. Jeder von euch könnte zum Thema Gebet bei Matthäus jetzt etwas sagen, weil er es wirklich herausgesucht hat. Prophetie bei Matthäus – ihr seid jetzt alle Experten, und das werden wir nachher in der Diskussion schon feststellen. Ihr kennt euch jetzt wirklich darin aus und sagt: Wunderbar, schön, dass ich das endlich weiß.
Vertiefung des Bibelstudiums: Fragen als Schlüssel zum Verstehen
Was gehört noch zum Bibelstudium dazu, zu dieser ganz einfachen Form? Es geht nicht nur darum, etwas mit einer bestimmten Fragestellung durchzulesen – und die Fragestellung kann ganz einfach sein.
Wenn ich mit einem biblischen Buch anfange, es zu studieren, lautet meine erste Frage: Wer hat das Buch geschrieben? Das bedeutet, ich lese ein biblisches Buch mit der Frage, was mir das Buch über den Autor sagt.
Vielleicht lacht ihr, wenn ihr einen Brief lest, der gleich am Anfang so beginnt: Paulus, Apostel Jesu Christi, den Heiligen in irgend einem Ort. Ihr denkt dann vielleicht: Was will man da noch herausziehen? Steht doch alles da. Aber das stimmt nicht.
Wenn ihr allein einen neutestamentlichen Brief mit der Fragestellung lest, was alles über den Autor steht – über seine Lebensumstände, seine Beziehung zu den Empfängern – und ihr schreibt das untereinander auf, dann zwingt ihr euch, beim einmaligen Durchlesen des Briefes ganz genau zu lesen. Und das ist der große Segen.
Die Gefahr, in der wir alle stecken – vielleicht ihr nicht so sehr, aber ich schon –, ist, dass ich oft beim Bibellesen noch etwas zerstreut im Kopf bin. Das passiert zum Beispiel kurz nach dem Aufstehen. Dann sage ich mir: Ich habe eine bestimmte Menge Bibel zu lesen, und die lese ich jetzt. Ob ich dabei etwas verstehe oder nicht, ist mir egal. Ob die Buchstaben in meinen Augen verschwimmen, ist mir auch egal. Hauptsache, ich habe gelesen.
Das ist eine gewisse Gefahr, in der ich zumindest stecke. Es sind einfach Lesegewohnheiten, die auf Pflichtbewusstsein beruhen. Man kann sich davor schützen, wenn man sich eine Frage stellt und sagt: Diese möchte ich jetzt anhand des Textes, den ich lese, beantworten.
Das ist eine ganz einfache Sache. Die Frage kann sein: Wer hat das Buch eigentlich geschrieben? Oder: Was erfahre ich über die Empfänger? Wo spielen die Handlungen? Das sind ganz einfache Fragen, die aber beim ersten, zweiten, dritten oder vierten Lesen eines Briefes helfen können, eine Gliederung zu formulieren und tief in den Text einzutauchen.
Wir werden nächstes Jahr, wenn ihr noch im Kurs über Bibelstudium dabei seid, genau das üben. Ihr werdet feststellen, dass man aus einer Frage wie „Wer hat einen Brief geschrieben?“ unendlich viele Anwendungen für das eigene Leben ziehen kann.
Es ist wirklich faszinierend, was man alles herausziehen kann, selbst wenn ihr jetzt denkt: „Blöde Frage, kann ich mir gar nicht vorstellen.“ Aber es ist so.
Die Bedeutung des Aufschreibens im Bibelstudium
Warum soll man Dinge aufschreiben?
Ihr könnt sagen, das sei ein Fehler, in den ich immer wieder bei meiner stillen Zeit falle: „Nee, ich bin jetzt zu müde, ich schreibe jetzt nichts auf.“ Doch ich kann es euch erraten, und ich bin jetzt einmal mehr dazu ermutigt worden, das doch zu tun.
Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das besagt, dass die schwächste Tinte stärker ist als das stärkste Gedächtnis. Und das hat etwas für sich. Eine Sache, die man entdeckt hat: Wenn man in der Bibel etwas aufschreibt und sich dann Gedanken macht, wie man das, was man gefunden hat, formuliert, ordnet das die eigenen Gedanken.
Oft ist es so: Man liest die Bibel und hat einen Eindruck davon, was ungefähr drinstehen könnte. In dem Moment, in dem ich mich hinsetze und das aufschreibe, gelingt es mir, meine Gedanken zu strukturieren. Dann bin ich auch in der Lage, Dinge weiterzugeben, weil ich sie wirklich verstanden habe. Und das ist ja ein Ziel.
Man könnte fragen: An wen soll ich das weitergeben? Zunächst einmal an mich selbst. Wenn ich etwas verstanden und formuliert habe, kann ich es selbst nutzen. Wenn es nur eine vage Idee ist, wenn ich nur einen vagen Eindruck davon habe, was im Text steht, und mich nicht diszipliniere, es aufzuschreiben, komme ich nur schwer zu dem, was ich persönlich „Anwendung“ nenne – also dem Umsetzen dessen, was im Text steht.
Ich versuche in meinem eigenen Leben, in der stillen Zeit ein Tagebuch zu führen – etwas ganz Antiquiertes –, in dem ich den Kerngedanken festhalte, der mich am meisten fasziniert von dem Text, den ich gelesen habe. Ich schreibe mir den Gedanken nochmals heraus, um zu verstehen: Was steckt da jetzt für mich persönlich drin?
Dadurch, dass ich es formuliert habe, verstehe ich es noch klarer und kann es auch in der Anwendung umsetzen. Darauf möchte ich später noch einmal eingehen.
Bibelstudium fängt dort an, wo wir das, was wir jetzt in der Lektion gemacht haben, fortsetzen. Während des Kurses ist das ganz einfach. Karl Heinz hat euch ja immer Aufgaben gestellt. Ihr musstet nach Leuten suchen, nach Themen, nach Ortschaften. Ihr werdet all diese klassischen Fragen sehen: Um wen kümmert es sich? Welche verschiedenen Themen gibt es? Wo findet das statt? Das macht ihr im Kurs durch.
Und die Idee ist natürlich, dass ihr so etwas auch danach weiterführt, weil er einfach sagt: Das war gut.
Der Zweck biblischer Bücher am Beispiel der Evangelien
Die zweite Frage für heute Abend lautet: Warum steht dieses Buch eigentlich in der Bibel? Warum sind zum Beispiel das Matthäusevangelium oder das Johannesevangelium Teil der Bibel? Was würde uns fehlen, wenn wir sie nicht hätten? Würde uns überhaupt etwas fehlen? Vielleicht würden wir denken: Eigentlich brauche ich es nicht. Wäre die Bibel immer noch vollständig, wenn wir das Matthäusevangelium nie gehabt hätten? Was ist das Besondere daran?
Das ist eine Frage, die man sich bei jedem Buch der Bibel stellen sollte. Was war der Zweck des Schreibers? Warum hat er es geschrieben? Wenn ich herausfinden möchte, wie man so etwas macht, wie würde ich vorgehen? Welche Ideen gibt es? Wie finde ich heraus, warum zum Beispiel das Johannesevangelium geschrieben wurde? Was ist der Zweck?
Okay, liest die Stelle vor. Hier ist eine Bibel, liest du dir das durch? Genau, bei Johannes ist es ganz einfach, weil er selbst sagt, warum es geschrieben worden ist. Für alle, die mitlesen wollen: Das ist Johannes 20,31.
Lest bitte vor:
„Es sind viele andere Zeichen von Jesus getan worden, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.“
Johannes fasst den Zweck seines Buches zusammen, wenn er schreibt: „Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.“ Damit wird ganz grob der Zweck des Johannesevangeliums angegeben.
Jetzt wird auch ein Stück weit sichtbar, warum es wirklich Sinn macht, das Johannesevangelium einzusetzen, wenn ich jemanden zum Glauben führen will. Johannes sagt also, sein Evangelium habe er geschrieben, damit die Leute wirklich glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes.
Entsprechend findet man im Johannesevangelium viele Argumente, Bilder und Argumentationsketten, die genau auf diesen Punkt hinführen. Immer dann, wenn ich den Zweck eines Buches kenne, habe ich logischerweise die Möglichkeit, es am besten einzusetzen.
Bei einem Zweck ist es oft so – und das kann man schon als Regel sagen –, wie bei einem Schlüssel in einer Tür: Der Schlüssel steckt entweder vorne oder hinten drin. So grob gesehen. Ähnlich verhält es sich mit dem Zweck eines Buches.
Wenn man nach dem Zweck eines Buches sucht, geben viele Autoren des Neuen Testaments irgendwo einen Hinweis, warum sie etwas schreiben. Wenn man schnell suchen will, dann sucht man hinten, wie bei Johannes, oder vorne.
Ein Beispiel, bei dem der Hinweis vorne steht, ist Matthäus. Matthäus 1 beginnt eigentlich ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht: Ihr verschenkt ein Neues Testament, und derjenige schlägt es auf Seite 1 auf. Dann denkt ihr: Hoffentlich liest er schnell über den Stammbaum hinweg! Denn wenn er das nicht schafft, verläuft er sich schon in den ersten sieben Versen.
Matthäus 1,1 lautet:
„Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.“
So fängt das Buch an. Vielleicht habt ihr ganz schnell über den Vers hinweg gelesen, weil ihr ihn schon kanntet. Aber an dieser Stelle wird ein Stück weit deutlich, was Matthäus will: Es ist das Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.
Die Bedeutung von Abraham und David als Verheißungsträger
Geschichte Israels
Abraham ist der Vater der jüdischen Nation. Die Reihenfolge ist bekannt: Abraham hat einen Sohn namens Isaak, der wiederum zwei Söhne hat, Jakob und Esau. Aus Jakob entstehen dann, vereinfacht gesagt, die zwölf Stämme Israels. Das stimmt nicht ganz, denn zwei der Stämme, die zu den zwölf gezählt werden, sind eigentlich seine Enkel. Aber wenn man es ganz einfach ausdrückt, stammen die zwölf Stämme Israels von Jakob ab.
Abraham ist also der Vater der jüdischen Nation. David hingegen hat eine ganz andere Bedeutung. Kann man sich vorstellen, wofür David steht? Genau, für das Königtum. Er ist die leuchtende Gestalt, wenn man an die königliche Familie denkt. Es ist nicht Saul, der eher ein weniger leuchtendes Vorbild ist, auch sein Sohn Salomo ist in vielerlei Hinsicht kein Vorbild mehr. David hingegen steht als Vorbild durch und durch da. Deshalb gibt es auch viele Predigten über ihn.
Was haben Abraham und David gemeinsam? Beide sind Verheißungsträger. Das heißt, Gott gibt ihnen ganz besondere Versprechen, die sich auf eine bestimmte Person beziehen – nämlich auf den Messias.
Schauen wir dazu in 1. Mose 12. Dort wird Abrahams Berufung deutlich. Zu der Zeit, als diese Berufung an ihn erging, wohnte Abraham noch nicht im Land Kanaan. Er sollte sein Heimatland verlassen. In 1. Mose 12,1-2 heißt es:
„Und der Herr sprach zu Abram – so hieß er damals noch, Abraham wurde er erst später genannt –: ‚Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen, dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein.‘“
Hier wird schon der Gedanke deutlich, dass Abraham ein Segen für andere sein soll.
Wie das konkret geschehen soll, wird an einer anderen Stelle noch klarer, nämlich in 1. Mose 22. Dort spricht Gott erneut zu ihm. Diese Stelle verwendet Paulus im Galaterbrief, um sie eindeutig auf Jesus Christus zu beziehen. In 1. Mose 22,15-18 heißt es:
„Und der Engel des Herrn rief Abraham vom Himmel her zum zweiten Mal zu und sprach: ‚Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie den Sand am Ufer des Meeres. Deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde einnehmen. Und in deinem Samen werden sich alle Nationen der Erde segnen, weil du meiner Stimme gehorcht hast.‘“
Paulus erklärt den Galatern, dass mit „in deinem Samen“ ganz klar eine einzelne Person gemeint ist, nicht eine Summe von Personen. Diese Verheißung bezieht sich auf Jesus Christus. Jesus ist der Nachkomme Abrahams, der zum Segen für die Nationen wird – letztlich für alle Menschen.
Matthäus möchte mit seinem Evangelium deutlich machen, dass das stimmt: Jesus ist ein Nachfahre Abrahams, und in ihm erfüllt sich die Verheißung, die an Abraham erging.
In ähnlicher Weise kommt nun David ins Spiel, denn auch er ist ein Verheißungsträger. Schauen wir dazu in 2. Samuel 7,12-13:
David war nicht immer König, sondern musste lange auf sein Königtum warten, obwohl er bereits gesalbt war. In 2. Samuel 7 ist er König über ganz Israel. Im Kapitel davor hat er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht, nachdem dies zuvor in einem Fiasko geendet war. Diesmal hat es geklappt. Die Geschichte erzählt, wie David halbnackt tanzend durch die Straßen zieht und seine Frau sich für ihn schämt.
Im Kapitel sieben stellt sich Gott zu seinem König und formuliert in den Versen 12 und 13 eine Verheißung:
„Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufrichten und sein Königtum festigen. Er wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums festigen.“
Dies ist ein wichtiger Begriff für Ewigkeit.
Wie David diese Verheißung verstand, zeigt sich in Vers 19, wo er sich im Gebet bei Gott bedankt:
„Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet.“
Das bedeutet: David war klar, dass seine königliche Linie ewig bestehen würde. Jedem Juden zur Zeit der Entstehung des Matthäusevangeliums war klar, dass ein Bruch passiert war. Die Verheißung war noch nicht erfüllt, sondern wirkte zeitlich begrenzt. Denn zu dieser Zeit herrschte in Jerusalem Herodes, der kein Jude war und mit der königlichen Familie nichts zu tun hatte.
Matthäus macht deutlich, dass Jesus nicht nur die Erfüllung der Segensverheißung an Abraham ist, sondern auch die Erfüllung der königlichen Verheißung des ewigen Königtums, die an David ergangen war.
Die Rolle Jesu als Erfüllung der Verheißungen und Retter
Wenn wir uns nun noch einmal fragen, wozu das Matthäusevangelium in der Bibel steht, dann ist es genau das: Wir sehen, wie sich aus dem Alten Testament stammend zwei Verheißungsstränge, die auf eine wirklich ferne Zukunft ausgerichtet waren, in Jesus, in der Person des Jesus von Nazaret, bündeln. So wie man Licht durch eine Lupe auf einen Punkt konzentrieren kann, bündeln sich diese Verheißungen auf eine Person. In dieser Person erfüllen sie sich tatsächlich.
Damit kommen wir zu dem, was Markus heute Morgen im Gottesdienst im Blick auf Prophetie und das Thema vom nächsten Sonntag angesprochen hat: Er zeigt, dass viele Verheißungen wie Lichtstrahlen durch diese Lupe auf einen Brennpunkt hinweisen. Dieser Brennpunkt ist Jesus. Genau das will Matthäus zeigen: Wer Jesus eigentlich ist.
Matthäus hat sein Evangelium als „Buch des Ursprungs Jesu Christi“ geschrieben. Er hat den Ursprung, den Anfang, also den Ort, woher Jesus kommt, im Blick. Dabei betont Matthäus nicht nur, dass Jesus die Erfüllung der Verheißungen an Abraham und David ist, sondern dass er gleichzeitig noch etwas anderes ist.
Dazu müssten wir nun Matthäus 1,19 betrachten. Denn es gibt ein weiteres Prinzip im Alten Testament. Dieses Prinzip heißt zum Beispiel in Hosea 13,4: „Es gibt keinen anderen Retter als mich.“ Gott sagt ganz eindeutig: Sucht jemand, der euch helfen kann, aber im Endeffekt bin ich es. Diese Linie findet man auch bei Jesaja. Die Propheten machen ganz klar: Retter im ureigensten Sinne kann nur Gott selbst sein.
Auch diese Linie wird von Matthäus aufgegriffen und in der Beschreibung der Geburt Jesu deutlich gemacht. In Matthäus 1,18 heißt es: „Die Geburt Jesu Christi aber verhielt sich so: Maria, seine Mutter, war dem Joseph verlobt; ehe sie zusammenkamen, wurde sie schwanger befunden vom Heiligen Geist.“
Damit macht Matthäus Folgendes deutlich: Er geht beim Ursprung zurück auf die alttestamentlichen Segens- und Verheißungslinien und sagt, dass all das in Jesus erfüllt wird. Gleichzeitig greift er auf das alttestamentliche Prinzip zurück, dass allein Gott Retter ist, und zeigt, dass in Jesus all das, was an Segen, Verheißung und Rettung vorhanden ist, auf eine Person konzentriert ist.
Jesus ist der Verheißungsträger schlechthin. Das ist das, was Matthäus zeigen will. Deshalb lesen wir im Matthäusevangelium so viele Prophetien und Bezüge zum Alten Testament. Wenn man ein Wort suchen möchte, das immer wieder im Matthäusevangelium vorkommt, dann ist es das Wort „erfüllt“. Immer wieder heißt es dort: erfüllt, hat erfüllt, wird erfüllt.
Dieses Wort ist ein Schlüsselbegriff, der durchgängig im Matthäusevangelium auftaucht. Würde man eine Analyse machen, wie oft jedes Wort vorkommt, würde „erfüllt“ ziemlich weit oben rangieren – zumindest deutlich häufiger als in den anderen Evangelien.
Das ist der Grund, warum Jesus im Matthäusevangelium als König vorgestellt wird – als der ewige König. Und das wisst ihr: Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Jesus möchte den bedrückten und beladenen Menschen sein königliches Joch auflegen. Er möchte ihnen seine Herrschaft geben und sie einladen, zu ihm zu kommen.
Er lädt sie ein, Teilhaber zu werden am Reich Gottes, an diesem Herrschaftsbereich, in dem er regiert. Dort setzt er seine Macht in Sanftmut und wohldosiert ein, um die Menschen, die müde, ausgelaugt und kaputt sind, aufzubauen. Er möchte sie zu sich ziehen, ihnen eine Heimat geben und ihre Seelen zur Ruhe bringen.
Das wird uns im Matthäusevangelium vorgestellt.
Die Vielfalt der Evangelien: Vier Seiten einer Person
Und vielleicht denkt ihr: Das ist ja wunderbar, wozu brauchen wir dann noch die anderen drei Evangelien? Das eine reicht doch schon. Wenn man das verstanden hat, ist das doch toll. Wozu brauche ich vier Evangelien, wenn ich aus einem schon so viele feine Sachen herauslesen kann?
Noch mehr feine Sachen, meinst du? Ja, das stimmt. Die Bibel selbst lässt viele Fragen offen – genauso wie sie uns nicht sagt, wo Gott herkommt oder warum die Erde erschaffen wurde. Die Bibel berichtet. Deshalb steht es auch nicht direkt in der Bibel, aber es gibt verschiedene Antworten, die wir kurz erwägen können: Warum gibt es vier Evangelien und nicht nur eins?
Eine Seite ist sicherlich das Thema Vielseitigkeit. Wenn wir Biografien von Menschen lesen, die uns beeindrucken, dann habe ich zumindest oft den Eindruck, dass ich den Menschen noch nicht richtig kenne, auch wenn ich eine Biografie gelesen habe. Das, was ich von ihm gehört habe, reicht mir eigentlich noch nicht aus. Ich würde gern noch mehr hören, noch mehr Facetten sehen.
Deshalb macht es Sinn – denn bei Jesus ist es genauso. Es ist schön, wenn wir Jesus als den König erkennen, der im Alten Testament prophezeit wurde. Super! Aber uns geht eine ganze Menge verloren, wenn wir die anderen Seiten Jesu nicht kennenlernen, die gerade in den anderen Evangelien beschrieben werden.
Im Matthäusevangelium geht es um den König, das Reich Gottes, die Prinzipien und die Ausbreitung des Reiches Gottes – all diese Themen. Bei Lukas liegt der Schwerpunkt … oder machen wir erst mal Markus: Markus hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Liest man Markus durch, könnte man denken, hier ist ja ein langweiliges Evangelium. Er erzählt immer wieder: „Und er machte das, und er machte das, und dann ging er dorthin und machte das, und dann kam das und das.“ Es ist eine Handlung nach der anderen, eine Action hintereinander.
Wer versucht, etwas Ordnung in das Markus-Evangelium zu bringen, zum Beispiel mit Unterüberschriften, wird merken – zumindest Jürgen und ich – dass das ziemlich kompliziert ist, weil es kein klares Gerüst gibt. Bei Matthäus dagegen ist es eindeutig: Wir haben Reden, Geschichten, Rede, Geschichten, Rede, Geschichten. Irgendwann denkst du: Na wunderbar, habe ich verstanden – Rede und Geschichten halt.
Markus dagegen zeigt eine Action nach der anderen. Warum? Weil Markus einen anderen Jesus darstellt? Nein! Markus zeigt eine andere Seite desselben Jesus, eine Seite, die Matthäus weglässt oder auf die Matthäus keinen Schwerpunkt legt: nämlich die Seite des Knechts, die Seite dessen, der sich im Dienst an den Menschen aufzehrt.
Deshalb ist der Schlüsselvers für das Markus-Evangelium auch Markus 10,45: Jesus hat gedient. Diese Dienerhaltung Jesu wird nirgendwo deutlicher als bei Markus. Man hat fast den Eindruck, die Wunder sind viel wichtiger als die Worte. Er ist nur unterwegs, nur am Machen. Das lassen die anderen Evangelien weg. Aber wir brauchen das. Wir müssen wissen, dass Jesus ein Mann war, der ruhelos für die Menschen war.
Aber das allein würde vielleicht auch nicht helfen. Vielleicht bringt uns Lukas weiter. Lukas erzählt uns etwas über Jesu Kindheit – wenn auch wenig. Er berichtet über sein Wachstum, wie Jesus herangereift ist. Nirgendwo anders lesen wir etwas über die gefühlsmäßige Seite Jesu. Das ist ein starkes Element in Lukas: Er zeigt, wie mitfühlend Jesus war. Seine menschliche Seite wird unglaublich betont.
Wenn wir den Stammbaum anschauen, der in Lukas überliefert ist, sehen wir einen Unterschied zu Matthäus. Lukas beschreibt den Stammbaum von Maria. Da geht es um die menschliche Seite. Matthäus dagegen zeigt die königliche Abstammung über seinen Stiefvater Josef.
All das zusammengenommen beschreibt Lukas nicht den Knecht, wie Markus, und nicht den König, wie Matthäus, sondern er beschreibt vielmehr den vollkommenen Menschen. Einen Menschen, der ausgeglichen in seiner Wesensart ist, aber doch menschliche Wesenszüge hat, die wir nachvollziehen können. Außerdem betont Lukas viel stärker als jeder andere das Gebetsleben Jesu. Das ist eine typisch menschliche Seite, denn Jesus Christus, der Gott ist, braucht im menschlichen Sinn das Gebet.
Dann haben wir Johannes. Johannes ist wahrscheinlich den meisten Leuten klar: Wie Lukas das Menschsein betont, legt Johannes den Schwerpunkt fast ausschließlich auf Jesu Göttlichkeit. Nirgendwo anders finden wir radikalere Aussagen. Das Wort Gottes wird Fleisch – zack! In den ersten achtzehn Versen kannst du jemandem die Dreieinigkeit und all die Dinge zeigen. Da bleibt nichts offen. Jesus Christus ist Gott – bumm!
Und das Wort Gottes „zeltete unter uns“, wohnte unter uns. So ähnlich wie die Stiftshütte unter den Israeliten zeltete, so ist jetzt Gott selbst im Fleisch erschienen. Im Johannesevangelium finden wir die „Ich-bin“-Worte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ Johannes macht radikale Aussagen. Er erhebt den Anspruch, den Jesus hatte, Gott zu sein, immer wieder zum Thema.
Immer wieder lesen wir von den Juden, die dagegen waren, die ihn steinigen wollten. Bei Johannes wird diese Ablehnung mit genau dieser Begründung geschildert. Im Vordergrund steht hier Jesus als Gott.
Wenn wir die vier Evangelien nebeneinanderlegen, sehen wir: Jesus, der König, verheißener Messias im Alten Testament; Jesus, der Knecht, der dient und fast ruhelos ist; Jesus, der vollkommene Mensch, an dem wir uns in unserer Menschlichkeit und Bedürftigkeit orientieren können; und Jesus, der Sohn Gottes, vollkommen, von Ewigkeit her kommend.
Diese vier Evangelien bilden nebeneinander gelegt vier unterschiedliche Seiten derselben Person ab. Zusammen ermöglichen sie uns einen realistischen Blick auf Jesus.
Es ist auch so: Diese vier Berichte bestätigen sich gegenseitig. Sie legen alle denselben Schwerpunkt auf die letzten Tage des Herrn Jesus und machen alle im Kern dieselbe Aussage. Egal, ob es Jesus der König ist, der dich in sein Reich ruft, ob es Jesus der Knecht ist, der sagt: „Ich bin für dich da“, ob es Jesus der vollkommene Mensch ist, der uns zeigt, wohin das führt – Vollkommenheit, nämlich in die Abhängigkeit von Gott, in die Beziehung zu Gott – oder ob es Jesus, der Sohn Gottes ist, der uns sagt: „Kommt her zu mir und glaubt an mich.“
Egal, was da ist: Alles zeigt uns ein Ziel. Damit bestätigen sich die Berichte auch untereinander.
Die innere Ordnung des Matthäusevangeliums
Ihr habt also Matthäus studiert. Sagt mir doch mal, wie die innere Ordnung von Matthäus ist. Womit fängt Matthäus an? Mit der Einleitung. Was kommt danach? Der Schluss? Nein, noch nicht ganz. Was kommt nach der Einleitung? Die Einleitung ist das, worüber wir uns die ganze Zeit unterhalten haben. Was kommt danach? Ich möchte jetzt einfach nur grob zehn Punkte oder so haben. Was kommt als nächstes? Als nächster großer Block. Dürfen sich alle beteiligen. Wie heißt das Ding, das du jetzt meinst? Wie bitte? Ja, die Bergpredigt ist allgemein bekannt, oder? Also haben wir als Nächstes die Bergpredigt.
Verzeiht mir meine Schrift, aber es soll ja schnell gehen. Was kommt nach der Bergpredigt? Schreibt eure Bibel auf, wenn ihr das nicht im Kopf habt. Was kommt nach der Bergpredigt? Gleichnisse, Heilungen, was noch? Berufung der Zwölf? Okay, also Gleichnisse, Heilungen. Ich weiß nicht, ob man versucht hat, das einem Thema zuzuordnen. Tenney macht das so ein bisschen. Was sind die Themen, um die es in diesem Block geht? Berufungen haben wir schon, also sehr viel auch um die Frage Nachfolge. Wie wird man Jünger? Das ist so ein Thema. Es geht auch ein bisschen um die Vollmacht Jesu, ob Jesus heilen kann, solche Sachen werden angesprochen.
Okay, das heißt, wir haben hier als nächsten Block das Thema Vollmacht, das wird aus den Wundern deutlich, und Nachfolge. Wobei Nachfolge alles Mögliche heißen kann. Ja, ich will mich da jetzt nicht festlegen. Was kommt danach? Ihr könnt das haben, ich habe das hier auch aufgeschrieben. Man muss ja nicht mitschreiben, arbeitet mit mir, ich schenke euch das Papier. Was kommt danach? Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen.
Wo kommen die Gleichnisse, und was kann die Gesagte als Erklärung seines Programms hin? Nein, das haben wir hier schon, in der Bergpredigt. Wir machen es gröber, ganz grob, so grob es nur irgendwie geht. Es war sehr grob. Nein, ein klein wenig feiner, Tobi. Was kommt als Nächstes? Als nächstes große Struktur in diesem Evangelium? Nein? Die Gleichnisreden auch nicht? Nein, die Gleichnisreden auch nicht dran. Schaut mal hin, das hatte doch Tenney herausgearbeitet. Einmal habt ihr im Block Ereignisse und dann kommt ein Redeblock. Block Ereignisse, Redeblock. Was ist der nächste, wenn wir hier Block Ereignisse haben? Was ist der nächste Redeblock?
In der nächsten Rede geht es tatsächlich um die Aussendung der Jünger. Wobei wir da schon mal im letzten Jahr darüber gesprochen haben: Die Aussendung ist schon mit viel Prophetie verbunden. Letztlich geht es um die Frage Vollmacht und Aussendung. Wo haben wir die Kraft her für unseren Dienst, und wie wird das weitergehen? Also Vollmacht und Aussendung der Jünger, logisch, der Jünger, Nachfolge der Jünger.
Was ist der nächste? Dann kommt wieder ein Block. Worum geht es im nächsten Block? Die ganzen Wunder, die jetzt kommen, und Geschichten? Was steht zu Ende? Wie bitte? Elf Vers? Wie bitte? 11,1. Wann kommt die nächste Rede? Kapitel 13. Worum geht es in der Rede? Einfach mal das schon zu haben: Gleichnisse. Aber worüber gehen die Gleichnisse? Reich der Himmel ist auffällig, oder? Es sind Gleichnisse, Gleichnisse, Gleichnisse, aber nicht irgendwelche, sondern es geht immer um das Reich der Himmel. Deswegen heißen sie auch Himmelreichs-Gleichnisse. Okay, Gleichnisse vom Himmelreich.
Und worum geht es in den Sachen davor? Wenn jemand deutlich machen möchte, schreibe ich das mal so: ja, gemischt. So, an dieser Stelle brechen wir mal ab, denn es ging mir nicht darum, jetzt die gesamte rhetorische Struktur noch mal durchzugehen. Das könnt ihr zuhause machen. Mir geht es um etwas Prinzipielles.
Wenn Matthäus sich hier hinsetzt und diese Ordnung hineinbringt, ist das erstens eine auffällige Ordnung. Denn ich könnte hier am Ende jeder Rede zeigen, dass immer das gleiche Wort steht: "Nachdem Jesus dies erfüllt hatte" oder "vollendet hatte". Es ist immer das Gleiche, leider in der Elberfelder unterschiedlich übersetzt zum Teil, aber im Griechischen ist es immer dasselbe Wort. Das heißt, er setzt hier quasi eine Zäsur, da eine Zäsur, da eine Zäsur.
Herr Hummer sagt immer, das habe ich schon mal gehört. Wenn das so ist, warum war das so? Warum diese Ordnung? Wie gesagt, bei Markus finden wir sie noch nicht, vielleicht ist sie drin, wir müssen noch ein bisschen suchen. Könnte er sagen: Na ja, klar, Matthäus war so ein alter Finanzbeamter, und vielleicht sind die einfach ein bisschen strenger, was Gliederung angeht. Nichts gegen Karsten, jetzt einfach nur so. Er war jemand, der halt gewohnt ist, Dinge ordentlich zu machen und nicht einfach irgendwie. Deswegen ordnet er das halt: Geschichte, Rede, Schnitt, Geschichte, Rede, Schnitt. Und vielleicht ist da was Wahres dran.
Wahrscheinlicher aber liegt es an etwas anderem. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns vorstellen müssen, wie damals die Bibel eigentlich verbreitet wurde. Wir denken immer: Na ja, Bibel heißt Bibel lesen. Habe ich ja vorhin gesagt, ist aber eigentlich falsch. Denn damals hatten die Leute gar keine Bibeln. Weißt du, da hatte nicht jeder zuhause so ein Ding. Nicht mal Paulus hat alle Schriften einfach so mit sich herumgeschleppt, wo man denken konnte: Na ja, der als Missionar muss doch alles haben.
Heute ist das ja auch so: Die besten Bibliotheken und die meisten Bücher haben die Missionare, zumindest in Berlin. Wenn ich ein gutes Buch brauche, wo ich sage, das gibt es fast nicht mehr zu kaufen, telefoniere ich bei den Missionaren in Ahren herum. Irgendwann hat einer das Bestünd im Schrank stehen. Paulus nicht. Paulus musste an einer Stelle schreiben: Bring mir die Schriften mit, die brauche ich jetzt. Hat er nicht dabei gehabt.
Damals war es ganz unüblich, dass Leute eine Bibel besaßen. Es war unbezahlbar. Deshalb hat man die Bibel auch nicht gelesen, sondern gehört. Es gab Leute, die haben vorgelesen. Paulus ermahnt Timotheus: Halte an am Vorlesen. Er sagt nicht: Schreib die Bibel ab und verteile sie ganz oft. Er sagt: Lies vor.
Entsprechend, wenn wir nach Einteilungen in der Bibel suchen, um die Struktur eines Buches kennenzulernen, brauchen wir nicht nach Kapiteln und Versen suchen. Die sind noch gar nicht so alt, sie sind erst in den letzten tausend Jahren entstanden: Kapitel, Verse und Zwischenüberschriften. Denn damals hat keiner die Bibel gelesen, es war gar nicht nötig. Aber nötig waren hörbare Einschnitte. Und hörbar sind Dinge, die sich ständig wiederholen.
Deswegen, wenn ihr die Bibel studiert und die Struktur eines Buches verstehen wollt, achtet auf Dinge, die man hören kann, auf Wiederholungen. Und diese Wiederholungen sind zum Beispiel so ein Ding: "Nachdem diese Rede erfüllt war." Wenn ich jetzt erst einmal so eine innere Logik habe und sage: Aha, dann ist bei Matthäus anscheinend immer ein Block. Und das ist anscheinend auch ein Block. Also ein Block besteht immer aus Geschichten plus Rede, das scheint zusammenzugehören.
Jetzt habe ich das einmal etwas genauer skizziert, damit ihr das seht. Im Block hier nach der Bergpredigt geht es in den Wundern tatsächlich um die Vollmacht Jesu, das könnt ihr verfolgen. Und es geht um das Thema Nachfolge. Schaut euch an: Die Zusammenstellung der Rede greift das Thema doch tatsächlich wieder auf. Na, das ist ja merkwürdig.
Wenn jetzt Jürgen sagt: "Hör her, die Gleichnisse vom Himmelreich, und davor ist irgendwie gemischt", dann kann er Recht haben. Aber das ist eine Frage, die man überdenken muss. Hatte er wirklich Recht? Oder kann es sein, dass die Gleichnisse vom Himmelreich hier und die Geschichten davor zusammengehören, dass da ein gleichartiges Thema aufgegriffen wird, das Matthäus entwickelt?
Wenn das so ist, lohnt es sich, an der Stelle einfach nachzuforschen und wirklich weiter zu graben. Ich denke, das wäre ein lohnenswertes Studium: einfach von der Bibel her zu schauen, an welcher Stelle Zusammenhänge zwischen den Geschichten und der Rede zu finden sind. Denn Matthäus macht eins ganz klar: Hier ist ein Marker, und hier ist ein Marker.
Das gehört ein bisschen zum Thema Bibelstudium dazu: zu sehen, wo in einem Buch Abschnitte sind, die zusammengehören, und zu verstehen, welche Themen dort behandelt werden.
Warum ist das wichtig? Wir wollen ja auch in unserer Auslegung nicht am Thema des Buches vorbeigehen. Du kannst ja alles in eine Bibelstelle hineinlegen. Aber es ist natürlich schön, wenn du sagen kannst: Die Bergpredigt möchte ich nicht aus dem Zusammenhang herausreißen, sondern ich möchte, dass die Bergpredigt in ihrem Zusammenhang bleibt.
Ich möchte mich fragen, warum die Bergpredigt an der Stelle steht, wo sie steht. Was will Matthäus damit machen? Warum ist das genau der Anfang und nicht andersherum? Warum steht die Bergpredigt nicht da, wo die Endzeitrede steht? Und umgekehrt: Er hätte ja auch mit der Endzeitrede anfangen können. Wie ist da der innere logische Aufbau?
Thematische und historische Perspektiven im Matthäusevangelium
Und eine weitere Sache zum Thema Aufbau wird bei Matthäus deutlich – und ganz besonders bei der Aussendungsrede. Wenn man diese Rede studiert, stellt man fest, dass mehrere Reden gleichzeitig kombiniert sind. Er beginnt mit einem Thema, sendet die Jünger aus, springt dann plötzlich in seiner Rede hin und her und landet irgendwann quasi in unserer Zeit.
Man muss sich fragen: Wie kommt das? Wie kann das sein? Die Rede scheint doch eigentlich halbwegs chronologisch aufgebaut zu sein. Wie macht das Sinn?
Es macht an dieser Stelle Sinn, wenn wir anfangen zu verstehen, wie die Griechen der damaligen Zeit mit Geschichte umgegangen sind. Wenn wir heute Geschichte lernen, dann lernen wir Jahreszahlen. Zum Beispiel 1066: Was war 1066? Oh Gott! William der Eroberer erobert irgendetwas, ich glaube England. Dann 1789, das müsst ihr wissen – falsch! Das war 200 Jahre vor meiner Hochzeit, aber auch die französische Revolution. Man muss immer von den wichtigen Ereignissen ausgehen, nicht von unwichtigen.
Wenn wir Geschichte lernen, dann lernen wir Jahreszahlen. Warum? Weil wir eigentlich denken, Geschichte lässt sich auf Jahreszahlen reduzieren. Der moderne Mensch – und dazu gehören wir auch – denkt, er könne aus der Geschichte nichts mehr lernen. In der Geschichte sind die dummen Alten, die alles falsch gemacht haben, und wir sind so modern und klug und machen alles richtig. Das ist leider das Denken des modernen Menschen. Aber er hat nicht Recht.
Viel mehr Recht haben die Griechen. Die Griechen gingen thematisch an die Geschichte heran. Sie wollten nicht nur Jahreszahlen lernen, sondern wissen, was sie aus der Geschichte herausziehen können, wo Entwicklungen sind, die sie nachvollziehen können, wie das eine aus dem anderen entsteht. Das war ihr Geschichtsverständnis. Jahreszahlen interessierten sie kaum. Wenn ihr mal nach einer Jahreszahl in einer griechischen Beschreibung sucht, könnt ihr verzweifeln.
Vielleicht findet ihr etwas wie: „Als der König sowieso regierte...“ und dann geht es um das Thema, wie sich eine Beziehung oder Geschichte entwickelt. Das interessiert die Griechen. Und das ist auch das, was Matthäus interessiert: Entwicklungen, Zusammenhänge, Themen, wie das eine aus dem anderen herauswächst. Das möchte er darstellen.
Deshalb erlaubt er sich in so einer Rede, in der es um Vollmacht und Nachfolge geht, einfach einen Sprung zu machen und zu sagen: „Okay, jetzt setze ich an dieser Stelle an und ziehe den Bogen über das gesamte Thema bis in unsere Zeit.“ Und plötzlich ist er in der Verfolgung der Neuzeit gelandet – gestartet mit der Aussendung der Jünger. Wow! Aber das ist Geschichte: wirklich den Bogen zu spannen bis in die Gegenwart.
Das macht Matthäus einfach. Er spannt den Bogen – die Endzeit dreht er auch schön –, er fängt an und kommt dann rüber in unsere Zeit. Das müssen wir im Hinterkopf behalten und nicht einfach nur auf Jahreszahlen Wert legen. Stattdessen sollten wir Geschichte im Neuen Testament als das sehen, was sie ist: eine Verbindung von Themen und Zusammenhängen.
Ermutigung zum intensiven Nachsinnen über die Bibel
Zum Schluss noch so viel: Warum zeige ich euch das hier? Ich möchte euch ermutigen, das zu tun, was Psalm 1 beschreibt. Psalm 1 ist so ähnlich wie das, was Tobi gerade macht. Tobi hat sich einen Keks genommen – nein, zwei Kekse, entschuldigung –, und er kaut darauf herum und schluckt ihn dann runter.
Wenn ihr ein besseres Bild sucht für das, was wir mit der Bibel tun sollen, dann denkt an Tobi und seine zwei Kekse. Es gibt kein besseres Bild. Wir kauen auf der Bibel herum, wir kauen und kauen und kauen. Psalm 1 sagt: Wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht.
Auch Josua 1,8 beschreibt dieses Prinzip, dass wir Tag und Nacht über die Bibel nachsinnen sollen. Und ich muss euch ein Geheimnis verraten: Nachsinnen funktioniert nur, wenn ihr Fragen habt. Ohne Fragen könnt ihr nicht sinnen.
Sinnen heißt nicht, wie manche Leute das leider tun, meditativ und irgendwie versunken im Wort zu sein. Sinnen heißt, Fragen an die Bibel zu haben. Das kann eine so simple Frage sein wie: Wer hat das Ding geschrieben? Dann liest du das durch und möchtest alles über den Autor herausfinden.
Plötzlich bekommst du eine Frage, du verstehst nicht, wie das ist, und dann denkst du weiter darüber nach. Sinnen kann auch bedeuten, dass du eine rhetorische Struktur zum Beispiel im Matthäusevangelium verstehst. Du merkst, dass es in der dritten Rede um die Gleichnisse vom Himmelreich geht.
Genau genommen geht es nicht nur um die Gleichnisse, sondern darum, wie die Strategie aussieht, dieses Himmelreich zu errichten. Dann stellst du dir die Frage, wie die Geschichten davor dazu passen. Haben sie einen Bezug? Können sie in meiner Auslegung eine Rolle spielen? Sind die Geschichten vielleicht aufeinander aufgebaut?
Denn Matthäus war nicht auf den Kopf gefallen und verfolgte eine Absicht damit. Dann fangt ihr an, nachzudenken. Ihr setzt euch mit eurer Bibel hin und unterstreicht Begriffe, die häufiger vorkommen. Vielleicht macht ihr euch sogar die Mühe herauszufinden, welcher Evangelist welche Stellen schreibt, um dann aus diesem Sondergut – den Begriff hatte ich das letzte Mal erklärt – abzuleiten, was er im Einzelnen gemeint hat.
Warum bringt Matthäus gerade das? Warum legt er so viel Wert auf die Petrusgeschichten, die man sonst nicht liest? Petrus taucht ständig auf und darf im Matthäus viel erfahren. Die anderen Evangelisten legen den Schwerpunkt nicht darauf. Warum? Viele Petrusgeschichten sind Sondergut bei Matthäus. Warum?
Und merkt ihr das, wenn ihr sagt: „Weiß ich nicht.“ An dieser Stelle entscheidet sich, ob man jemand wird, der über das Wort Gottes nachsinnt, oder jemand, der das Wort Gottes weglegt. Wenn du sagst: „Warum? Aber es interessiert mich eigentlich nicht“, dann wirst du nie jemand werden, der wirklich ins Wort hineingräbt.
Wenn du aber sagst: „Warum? Und es interessiert mich, wie könnte ich da vorgehen?“ – muss jetzt nicht die Frage sein, es kann irgendeine Frage sein – und du immer wieder eine Frage parat hast, immer wieder Punkte, an denen in deiner Bibel ein Fragezeichen am Rand steht, wo du sagst: „Weiß ich noch nicht, verstehe noch nicht, der Zusammenhang ist mir noch nicht klar.“
Was meint er bei 2. Mose am Anfang, wenn der Pharao verstockt ist? Wer hat da wen verstockt? Wie lief diese Sache? Ist Gott vielleicht doch ungerecht, dass er den Pharao hier verstockt und ihm gar keine Chance gibt? Was soll das dann mit den Plagen? Das sind offene Fragen, da muss man durch.
Wie ist das mit Leid und Not in der Welt? Das sind Fragen, auf die wir Antworten brauchen. Wir bekommen die Antworten nicht, indem wir einfach nur Sekundärliteratur, also Bücher über die Bibel, lesen. Sondern indem wir selbst kauen, kauen, kauen.
Und das Schöne ist: Es ist wie bei einem guten Mittagessen. Man setzt sich hin, ist ein bisschen im Stress, hat eigentlich keine Zeit und denkt: „Komm, schnell runterhauen.“ Und dann sitzt man da gemütlich. Je länger man sitzt, desto mehr Zeit hat man. Irgendwann freut man sich schon auf den Kaffee und denkt: „Eigentlich eine schöne Sache.“
So ähnlich geht es mir persönlich, und ich hoffe euch auch beim Bibelstudium. Man fängt an mit einer ganz zähen Frage. Irgendetwas, bei dem man sagt: „Das müsste ich mir mal anschauen.“ Oder ich mache es eher so: Ich sage, ich möchte jetzt mal ein biblisches Buch studieren. Vielleicht möchte ich nur schauen, ob ich eine rhetorische Struktur herauskriege.
Also einfach nur Geschichten zueinander puzzeln, was zu was gehört, gibt es ein Oberthema, finde ich irgendetwas, das zusammengehört? Nach ungefähr einer halben Stunde packt mich die Begeisterung. Nach ungefähr zwei Stunden tut es mir immer unglaublich leid, dass ich aufhören muss, weil jeder nicht ewig viel Zeit hat.
Das ist es, was ich euch wünsche: Diese Begeisterung für das Wort Gottes, dieses Draufrumkauen, dieses Runterschlucken, dieses immer wieder neue Nachdenken über das Wort Gottes, immer wieder neue Fragen zu stellen. Nicht nur plump drüberlesen, sondern wirklich solche Leute zu werden, die das Wort Gottes in sich aufnehmen.
Am Ende dieser Aufnahme steht hoffentlich nicht nur ein dicker Kopf, sondern ein verändertes Leben. Denn darum geht es wirklich.
Vielen Dank an Jürgen Fischer, dass wir seine Ressourcen hier zur Verfügung stellen dürfen!
Seine App "Frogwords" gibt's für Android und iOS.
Jürgens aktuellste Gebets-Infos gibt's hier zum Lesen und Abonnieren.